Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko
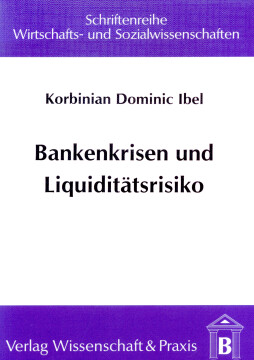
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko
Schriftenreihe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Vol. 45
(2001)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
In der Arbeit wird der Zusammenhang von Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko untersucht. Den Ausgangspunkt der Analyse bildet eine Beschreibung ausgewählter Bankenkrisen der letzten 130 Jahre. Der sich daran anschließende, theoretische Teil der Arbeit analysiert das von Banken im Rahmen ihrer Versicherungsfunktion getragene Liquiditätsrisiko. Die Einführung eines wohl definierten Konkursrechts sowie von Einlagensicherungssystemen ermöglicht die Eliminierung der Gefahr panikbasierter Bank Runs. Neben ordnungspolitischen Eingriffen in den Bankensektor kann optimale Bankenregulierung jedoch auch in einer Verlagerung von Aufgaben der Banken auf den Kapitalmarkt bestehen. Durch den geschickten Einsatz von Derivaten lässt sich die Versicherungsfunktion von Depositenverträgen bei gleichzeitiger Umgehung der Bank Run Gefahr abdecken. Im letzten Teil der Arbeit wird die Behandlung von Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko durch die Vorstellung einer Reihe wichtiger Ansätze der modernen Bankenkrisenliteratur zum Thema Liquiditätsrisiko, Contagion und optimaler Bankenregulierung abgerundet.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 8 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 10 | ||
| Tabellenverzeichnisverzeichnis der verwendeten Symbole | 13 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 16 | ||
| 1 Einleitung | 19 | ||
| Teil I | 25 | ||
| 2 Ein Überblick über Bankenkrisen | 26 | ||
| 2.1 Krisen vor dem Zweiten Weltkrieg | 27 | ||
| 2.2 Die Krise der Thrifts in den USA (1979-1994) | 37 | ||
| 2.3 Die Bankenkrise in Skandinavien (1987-1994) | 46 | ||
| 2.4 Die Krise in Japan (ab 1989) | 51 | ||
| 2.5 Die Asienkrise (1997/ 1998) | 59 | ||
| 2.6 Überblick über Bankenkrisen - ein Fazit | 73 | ||
| Teil II | 77 | ||
| 3 Das Bank Run Modell | 78 | ||
| 3.1 Die Ökonomie | 79 | ||
| 3.2 Der optimale Versicherungsvertrag | 80 | ||
| 3.3 Depositenverträge unter idiosynkratischem Risiko | 82 | ||
| 3.4 Eliminierung des Bank Run Gleichgewichts durch Backward Induction | 86 | ||
| 3.5 Depositenverträge unter aggregiertem Risiko | 90 | ||
| 3.6 Fazit | 92 | ||
| 4 Private Information und eindeutige Bank Run Gleichgewichte | 93 | ||
| 4.1 Private Information als Koordinierungsmechanismus | 94 | ||
| 4.2 Bank Runs bei privater Information | 97 | ||
| 4.3 Die Einführung privater Information - Fazit | 104 | ||
| 5 Mutual Funds und Einlagenkontrakte mit komplexer Suspension | 106 | ||
| 5.1 Mutual Funds und Liquiditätsschocks | 106 | ||
| 5.2 Einlagenkontrakte mit komplexen Suspensionsmechanismen | 108 | ||
| 5.3 Die Wirkung eines wohldefinierten Konkursrechts | 115 | ||
| 6 Hedging zur Absicherung von Liquiditätsschocks | 133 | ||
| 6.1 Beispiel: 2 Agenten und t = 0,5 | 134 | ||
| 6.2 Der Market Maker | 137 | ||
| 6.3 Hedging mit vielen Agenten | 138 | ||
| 6.4 Idiosynkratisches Risiko | 140 | ||
| 6.5 Aggregiertes Risiko | 141 | ||
| 6.6 Robustheit der Ergebnisse: Side Trading | 142 | ||
| 6.7 Fazit und Zusammenfassung | 144 | ||
| 7 Anwendung der Konzepte - der Fall eines Emerging Market | 145 | ||
| 7.1 Volkswirtschaftliche Kosten frühzeitiger Projektliquidierung | 146 | ||
| 7.2 Hedging und Einlagenkontrakte in Emerging Markets | 148 | ||
| 7.3 Fazit und Zusammenfassung | 155 | ||
| 8 Bank Runs, Depositenverträge und Hedging - Zusammenfassung | 156 | ||
| Teil III | 159 | ||
| 9 Bankenkrisen und Bank-Kundenbeziehungen | 160 | ||
| 9.1 Das Modell | 161 | ||
| 9.2 Unantizipierte Schocks | 167 | ||
| 9.3 Linderung von Bankenkrisen | 168 | ||
| 9.4 Zusammenfassung | 169 | ||
| 10 Contagion und Bankenkrisen | 170 | ||
| 10.1 Contagion bei Informationsasymmetrien | 171 | ||
| 10.2 Contagion und Interbankenmärkte | 176 | ||
| 10.3 Contagion - Fazit und Zusammenfassung | 184 | ||
| 11 Ein alternativer Ansatz - Optimale Bankenkrisen | 185 | ||
| 11.1 Das Grundmodell | 186 | ||
| 11.2 Optimales Risk Sharing | 186 | ||
| 11.3 Der Effekt von Liquidierungskosten | 189 | ||
| 11.4 Vorzeitige Liquidierung langfristiger Projekte | 191 | ||
| 11.5 Fazit und Zusammenfassung | 193 | ||
| 12 Schlußbemerkungen | 195 | ||
| 13 Anhang | 199 | ||
| 14 Literaturverzeichnis | 223 |
