Missbrauchsverbot und Standardisierung
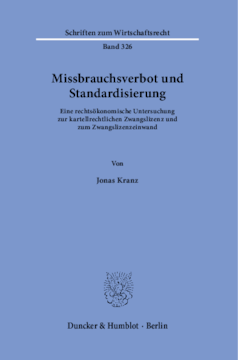
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Missbrauchsverbot und Standardisierung
Eine rechtsökonomische Untersuchung zur kartellrechtlichen Zwangslizenz und zum Zwangslizenzeinwand
Schriften zum Wirtschaftsrecht, Vol. 326
(2021)
Additional Information
Book Details
About The Author
Jonas Kranz studierte Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen und an der Universität Thessaloniki. Die Erste Juristische Staatsprüfung erfolgte 2016. Von 2016 bis 2020 war er als wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ernst-Joachim Mestmäcker am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg tätig. Für seine von Prof. Dr. Reinhard Ellger, LL.M. (Univ. of Penn.) betreute Dissertation verbrachte er Forschungsaufenthalte am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, als auch an der Wirtschaftsuniversität Bocconi. Seit 2019 ist er Referendar am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg.Abstract
Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts überziehen sich die internationalen IT-Konzerne weltweit mit Unterlassungsklagen, auch um ihre Konkurrenten im Wettbewerb zu behindern. Dieses »patent wars« genannte Phänomen wurde erst dadurch möglich, dass die patentgestützte Standardisierung das Rückgrat der digitalen Revolution darstellt und entsprechend massiv ausgebaut wurde. Das Kartellrecht entwickelte bislang nur zögerlich Antworten auf die Fragen, die sich daraus ergeben, dass Patente als Werkzeug zur Wettbewerbsbehinderung und -verhinderung missbraucht werden. Die Ursprünge dieser Entwicklung liegen in der kartellrechtlichen Zwangslizenz, dessen Entwicklungslinien in der vorliegenden Arbeit nachgezeichnet werden. Zudem werden der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand und die ökonomischen Faktoren, die dazu führen, dass dieser angeordnet werden muss, untersucht. Dabei werden die unterschiedlichen Herangehensweisen der deutschen, europäischen und US-amerikanischen Judikatur beleuchtet.»The Prohibition of Abusive Practices and Standardization«The author examines the antitrust law compulsory license and the antitrust law compulsory license objection, as well as their economic implications against the background of ubiquitous standardization. Thereby, the decisions of the German, as well as the European courts are presented and illuminated, in order to subsequently examine whether the judgments also correspond to the findings from the economic sciences.
