Lebensschutz für den Embryo in vitro
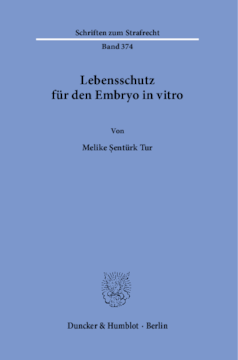
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Lebensschutz für den Embryo in vitro
Schriften zum Strafrecht, Vol. 374
(2021)
Additional Information
Book Details
Abstract
Die rasanten Entwicklungen im Bereich der Human- und Fortpflanzungsmedizin haben unsere traditionellen Vorstellungen bezüglich des Entstehens des menschlichen Lebens, der Schwangerschaft und Mutterschaft radikal verändert und sie erregen zunehmend Aufmerksamkeit. Aufgrund der Entwicklungen neuer Methoden in der Reproduktionsmedizin und der durch sie ermöglichten stetig zunehmenden Zugriffsmöglichkeiten in das vorgeburtliche Leben ist die Suche nach einer Antwort auf die Frage nach dem Lebensbeginn wichtiger geworden, um markieren zu können, ab wann der Embryo in vitro rechtlichen Schutz genießt und, damit verbunden, um die Zulässigkeit von Eingriffen an menschlichen Embryonen bestimmen zu können. Diese Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es notwendig ist, ein umfassendes und präzises Fortpflanzungsmedizingesetz zu normieren, weil das ESchG viele Lücken und Unklarheiten aufweist und durch neue medizinische Fortschritte an einigen Stellen überholt wird.»Protecting the Life of the Embryo In Vitro«This book explores the question of when exactly human life begins and benefits from protection of life. To address the issue of protection of human life, the hotly debated question of the legal status of the embryo is examined. This research concludes that because The Embryo Protection Act has many gaps and confusions, and in some places has failed to catch up with the new medical advances, it is necessary to make a comprehensive and precise reproductive medicine law.
