Moderne Industriegesellschaft
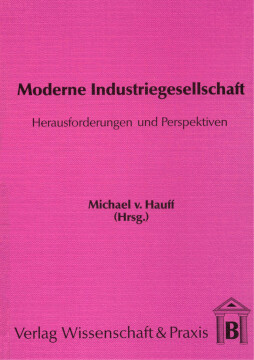
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Moderne Industriegesellschaft
Herausforderungen und Perspektiven
Editors: Hauff, Michael von
(1991)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Moderne Industriegesellschaften wie die Bundesrepublik Deutschland haben eine beachtliche Eigendynamik entwickelt, die sich in Zukunft mit noch stärkerer Intensität fortsetzen wird. Die Analyse und gezielte Mitgestaltung wird insofern für den einzelnen Wissenschaftler bzw. für die einzelne Wissenschaftlerin immer schwieriger, da die Eigendynamik mit einer enormen Diversifizierung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse einherging.Diese Problematik wird im vorliegenden Werk aufgearbeitet, indem renommierte Autoren aus unterschiedlichen Fachgebieten zu den drei Themenkreisen - gesellschaftspolitische Aspekte und Perspektiven, wirtschaftspolitische Anforderungen und unternehmenspolitische Herausforderungen moderner Industriegesellschaften - Stellung nehmen.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Ausgewählte Publikationen | 9 | ||
| Inhaltsübersicht | 11 | ||
| 1. Gesellschaftspolitische Aspekte und Perspektiven | 15 | ||
| Gerhard Kobel: Die Rationalisierung der Welt bei beschränkter Rationalität – Aufgaben und Schwierigkeiten der Wirtschaftswissenschaften angesichts der Herausforderungen der Gegenwart | 17 | ||
| 1. Das Allais-Paradoxon und andere Entscheidungsanomalien | 18 | ||
| 2. Soziale Dilemmata | 20 | ||
| 3. Herausforderungen der Gegenwart | 21 | ||
| 4. Die gesellschaftliche Rolle der Wissenschaften | 27 | ||
| 5. Anforderungen an die Wirtschaftswissenschaften | 29 | ||
| Literatur | 35 | ||
| Heidi Heilmann: Benutzerfreundliche Informationssysteme: Standardisierung oder Adaption an die Bedürfnisse des Endbenutzers? | 37 | ||
| 1. Problemstellung | 37 | ||
| 2. Standardisierung und Adaption als Merkmale benutzerfreundlicher Informationssysteme | 38 | ||
| 2.1 Qualifikationskriterien für Informationssysteme | 38 | ||
| 2.2 Standardisierung und Adaption als Bestandteile von Qualität | 40 | ||
| 3. Realisierung von Standardisierung und Adaption | 42 | ||
| 3.1 Funktions-, Daten- und Schnittstellenmodellierung | 42 | ||
| 3.2 Modulare Standardanwendungssoftware | 43 | ||
| 3.3 Gestaltung der Benutzungsschnittstelle | 44 | ||
| 4. Ausgewogenheit zwischen Standardisierung und Adaption | 46 | ||
| Literatur | 48 | ||
| Günter Endruweit: Entscheidungskriterien bei der Standortplanung für Wohngebiete und Gewerbebetriebe. Eine empirische Vergleichsuntersuchung in zwei Regionen Baden-Württembergs | 49 | ||
| 1. Das Entscheidungsproblem bei der Flächeninanspruchnahme | 49 | ||
| 2. Untersuchungsansatz | 50 | ||
| 3. Ergebnisse | 53 | ||
| 3.1. Entwicklung der Schlüsseldaten | 53 | ||
| 3.2. Wohnungsbaupolitik der Gemeinden | 55 | ||
| 3.2.1. Wohnungsbau für Bevölkerungswachstum | 56 | ||
| 3.2.2. Probleme des Mobilitätsverhaltens | 57 | ||
| 3.2.3. Planung und Nachfrageverhalten | 58 | ||
| 3.2.4. Erfolge der Wohnbauplanungen | 60 | ||
| 3.2.5. Zusammenfassung | 60 | ||
| 3.3. Gewerbebaupolitik der Gemeinden | 60 | ||
| 3.3.1. Grundzüge der kommunalen Gewerbebaupolitik | 61 | ||
| 3.3.2. Probleme bei der Gewerbebauplanung | 63 | ||
| 3.3.3. Erfolge der Gewerbebauplanungen | 65 | ||
| 3.3.4. Zusammenfassung | 67 | ||
| 4. Standortplanung und Flächeninanspruchnahme | 67 | ||
| 4.1. Wohnstandorte | 68 | ||
| 4.1.1. Das Preisproblem | 68 | ||
| 4.1.2. Das Lückenproblem | 69 | ||
| 4.1.3. Das Sekundärbauproblem | 70 | ||
| 4.2. Gewerbestandorte | 71 | ||
| 4.2.1. Das Bauformproblem | 71 | ||
| 4.2.2. Das Unternehmenssubventionsproblem | 72 | ||
| 4.2.3. Das Zielsicherungsproblem | 72 | ||
| 4.2.4. Das Erweiterungssicherungsproblem | 73 | ||
| 5. Schlußbemerkung | 74 | ||
| Anmerkungen | 74 | ||
| Literatur | 77 | ||
| Udo Kornblum: Aktuelle Probleme des deutschen Rechts der Freien Berufe | 79 | ||
| I. Einführung | 79 | ||
| II. Aktuelle Probleme des deutschen anwaltlichen Berufsrechts | 81 | ||
| 1. Allgemeines | 81 | ||
| 2. Die alte Bundesrepublik Deutschland | 81 | ||
| 3. Die ehemalige DDR | 86 | ||
| 4. Ausländische Rechtsanwälte | 87 | ||
| III. Zusammenfassung und Ausblick | 88 | ||
| Literatur | 88 | ||
| 2. Wirtschaftspolitische Anforderungen | 91 | ||
| Hans Rühle von Lilienstern: Erfolgreiche Strukturpolitik durch Kooperation – zunehmende Interdependenz und Affinität | 93 | ||
| 1. Veränderungen von Inhalt und Formen der Kooperation | 93 | ||
| 2. Die Bedeutung der Kooperation als Instrument der Strukturpolitik | 96 | ||
| 3. Unternehmensbezogene Strukturpolitik durch Kooperation | 97 | ||
| 4. Die Notwendigkeit der Integration ökonomischer, soziologischer und psychologischer Determination der Kooperation als Voraussetzung erfolgreicher Strukturpolitik | 98 | ||
| Literatur | 99 | ||
| Michael v. Hauff: Industriepolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Zur Kontroverse ihrer Einordnung und Relevanz | 101 | ||
| 1. Abgrenzungsprobleme der Industriepolitik | 101 | ||
| 2. Die industriepolitische Kontroverse | 103 | ||
| 3. Strukturwandel des industriellen Sektors anhand ausgewählter Indikatoren | 105 | ||
| 4. Ansätze einer aktiven Industriepolitik | 107 | ||
| 4.1 Industriepolitik für schrumpfende und stagnierende Branchen | 108 | ||
| 4.2. Förderung von expandierenden Produktionszweigen | 109 | ||
| 4.3 Industriepolitische Förderung von Unternehmen bzw. Unternehmensbranchen im internationalen Wettbewerb | 110 | ||
| 5. Resümee | 112 | ||
| Literatur | 113 | ||
| Frank C. Englmann: Die Wirkungen einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik im Diffusionsprozess von Innovationen | 117 | ||
| 1. Einleitung | 117 | ||
| 2. Das ursprüngliche Modell: Positive Beschäftigungswirkungen während des Diffusionsprozesses | 119 | ||
| 3. Produktivitätsorientierte Lohnpolitik (POLP): Die positiven Beschäftigungswirkungen verschwinden | 125 | ||
| 4. Fazit | 129 | ||
| Literatur | 130 | ||
| Wolfgang Bohling: Einige Bemerkungen zum Subventionsabbau in der Marktwirtschaft | 133 | ||
| Literatur | 143 | ||
| Hermann Schnabl: Auf dem Wege in die Dienstleistungsgesellschaft? Zwei Dekaden bundesdeutscher Strukturevolution unter der Lupe | 145 | ||
| 1. Einleitung | 145 | ||
| 2. Das Strukturierungsverfahren der MFA | 146 | ||
| 3. Die Darstellung der MFA-Strukturen | 149 | ||
| 4. Die Ergebnisse der MFA für die letzten zwei Dekaden | 150 | ||
| 4.1 Die Aktuelle Struktur 1970–1988 | 151 | ||
| 4.2 Standardstruktur 1970–1988 | 155 | ||
| 5. Schlußbemerkungen | 155 | ||
| Anhang | 156 | ||
| Literatur | 157 | ||
| Karin Thöne: Transformation der ostdeutschen Wirtschaft-eine wirtschaftspolitische Herausforderung | 159 | ||
| I. Die Besonderheiten der wirtschaftspolitischen Lage | 159 | ||
| Die kleinen Schritte zur europäischen Integration | 159 | ||
| Die Desintegration des RGW und der Umbau osteuropäischer Volkswirtschaften | 160 | ||
| Die Wiedervereinigung Deutschlands | 161 | ||
| II. Transformation des Wirtschaftssystems Ostdeutschlands | 161 | ||
| Reformen oder revolutionäre Veränderung von Wirtschaftssystemen | 161 | ||
| Die besonderen Vorgänge in Osteuropa und in der DDR | 162 | ||
| III. Die Gestaltung des Transformationsprozesses | 163 | ||
| Privatisierung des Produktionsvermögens | 164 | ||
| Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt | 166 | ||
| Finanzierungsaspekte | 168 | ||
| IV. Fazit | 169 | ||
| Literatur | 170 | ||
| Hans-Gert Braun: Unternehmerförderung in Entwicklungsländern | 173 | ||
| 1. Die Förderung der Privatwirtschaft als Säule der Entwicklungspolitik | 173 | ||
| 2. Die DEG – Das Institut der Bundesrepublik zur Förderung privater Unternehmen in der Dritten Welt | 176 | ||
| 3. Resümee und Ausblick | 179 | ||
| Helge Majer: Anreizsysteme für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung | 181 | ||
| A. Die Art der vorherrschenden Wirtschaftsweise erweist sich zunehmend als unverantwortlich für Mensch und Natur | 181 | ||
| B. Die vorherrschende Wirtschaftsweise muß durch eine nachhaltige Wirtschaftsweise ersetzt werden | 183 | ||
| C. Das menschliche Verhalten in wichtigen Industrieländern befindet sich im Umbruch von Egoismus zu verantwortlichem Handeln | 184 | ||
| E. Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (NAWI) erfordert Begrenzungen | 187 | ||
| F. Anreizsysteme für NAWI stellen hohe Anforderungen | 190 | ||
| G. NAWI erfordert eine neue internationale Weltordnung | 191 | ||
| H. Das Fazit | 193 | ||
| Literatur | 193 | ||
| 3. Unternehmenspolitsche Herausforderungen | 195 | ||
| Heinz Griesinger: Aus- und Weiterbildung als Zukunftsinvestition | 197 | ||
| 1. Die Berufsausbildung | 197 | ||
| 2. Zukünftige Anforderungen an die Berufsausbildung | 198 | ||
| 2.1 Attraktivität der Berufsausbildung | 198 | ||
| 2.2 Bessere Berufsinformation und -beratung | 198 | ||
| 2.3 Weiterentwicklung von Ausbildungsberufen | 199 | ||
| 2.4 Neue Anforderungen an die Berufsausbildung | 200 | ||
| 2.5 Die Berufsschulen | 201 | ||
| 2.6 Benachteiligte Gruppen | 201 | ||
| 2.7 Mädchen | 202 | ||
| 2.8 Berufsausbildung in den neuen Bundesländern | 203 | ||
| 2.9 Berufsausbildung und Europäischer Binnenmarkt | 203 | ||
| 3. Die Weiterbildung | 204 | ||
| 4. Aufgaben der Weiterbildung | 205 | ||
| 4.1 Fachliche Weiterbildung | 205 | ||
| 4.2 Allgemeine Weiterbildung | 206 | ||
| 4.3 Die Führungskräfteschulung | 206 | ||
| 5. Praktische Vorgehensweise im Betrieb | 207 | ||
| 5.1 Teilnehmer-Auswahl | 207 | ||
| 5.2 Bildungs-Organisation | 207 | ||
| 5.3 Zusammenarbeit mit externen Bildungsträgern | 208 | ||
| 5.4 Bildungsmethoden | 208 | ||
| 6. Zusammenfassung | 209 | ||
| Literatur | 209 | ||
| Werner Rössle: Aus- und Weiterbildung lern Handwerk als strategischer Erfolgsfaktor – Erfolgreiche und neue Konzepte | 211 | ||
| 1. Weiterbildungskonzept LANDESAKADEMIE des HANDWERKS | 212 | ||
| 2. Abitur, Gesellenbrief, Studium | 215 | ||
| 3. Resümee | 220 | ||
| Literatur | 221 | ||
| Michael Reiss: Personalarbeit statt Organisationsarbeit? Selbstorganisation als Herausforderung für Personalmanagement und Organisationsgestaltung | 223 | ||
| 1. Komplementarität und Substitutionalität in der Unternehmungsführung | 223 | ||
| 2. Der Verdrängungsverbund zwischen Organisations- und Personalarbeit | 228 | ||
| 3. Personalpolitische Handhabung des Selbstorganisationspotentials | 233 | ||
| 4. Organisatorische Handhabung des Selbstorganisationspotentials | 235 | ||
| 5. Integrierte Handhabung des Selbstorganisationspotentials | 237 | ||
| Literatur | 239 | ||
| Karl-Friedrich Ackermann: Kooperation – notwendige Grundlage und Voraussetzung für ein erfolgreiches Personalmanagement im Unternehmen | 243 | ||
| 1. Zur Bedeutung des Kooperationskonzepts von R. Endress für Theorie und Praxis des Personalmanagements | 243 | ||
| 2. Belastungsproben für die Kooperation im Personalbereich | 247 | ||
| 3. Diagnose des Kooperationsproblems im Personalbereich | 250 | ||
| 4. Von der Diagnose zur Therapie: Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Kooperation im Personalbereich | 256 | ||
| 5. Zusammenfassung | 258 | ||
| Literatur | 259 | ||
| Péter Horváth: Integratives Management und Controlling | 261 | ||
| 1. Veränderter Kontext und Anforderungswandel für das Management | 261 | ||
| 1.1 Überforderung und Unsicherheit der Führungskräfte | 261 | ||
| 1.2. Grundlegender Wandel von Wettbewerb und Kostenstrukturen | 262 | ||
| 2. Konzept des integrativen Managements | 263 | ||
| 2.1. Der Grundgedanke | 263 | ||
| 2.2 Schnittstellenüberwindung als vorrangige Aufgabe | 264 | ||
| 2.3. Realisierungsansätze integrativen Managements | 266 | ||
| 3. Controlling als integrierende Führungsunterstützungsfunktion | 267 | ||
| 3.1. Integrativer Ansatz des Controlling | 267 | ||
| 3.2. Gefahren der Desintegration | 267 | ||
| 4. Entwicklungstrends des Controlling | 269 | ||
| 4.1. Problemadäquates Integrationsverständnis | 269 | ||
| 4.2. Integrative Aufgabenwahrnehmung | 269 | ||
| 4.3. Schnittstellenüberwindende Organisationsstrukturen | 271 | ||
| 4.4. Integrative Instrumente | 272 | ||
| 5. Fazit | 277 | ||
| Literatur | 278 | ||
| Erich Zahn: Technologiemanagement – eine Herausforderung für die Unternehmensführung | 281 | ||
| 1. Warum ist Technologiemanagement notwendig? | 281 | ||
| 2. Kritische Aufgabendes Technologiemanagements | 285 | ||
| 3. Die Unterstützung der strategischen F+E-Planung | 291 | ||
| Literatur | 294 | ||
| Heinz Stark: Beziehungsmanagement im industriellen Einkauf – Ansatzpunkte zur Gestaltung von Zuliefer-Abnehmer-Partnerschaften | 295 | ||
| 1. Einleitung | 295 | ||
| 2. Trend zum strategisch ausgerichteten Einkauf | 296 | ||
| 3. Wandel in der Bedeutung von Zuliefer-Abnehmer-Beziehungen | 298 | ||
| Innovationspotential | 300 | ||
| Integrationspotential | 301 | ||
| Flexibilitätspotential | 301 | ||
| Verbundpotential | 302 | ||
| 4. Zulieferorientiertes Beziehungsmanagement des Einkaufs | 303 | ||
| 4.1 Ziele | 303 | ||
| (1) Bestmöglicher Beitrag zu den Beschaffungszielen | 303 | ||
| (2) Anregungen von Zuliefersynergien | 304 | ||
| (3) Kontinuität der Geschäftsbeziehungen | 304 | ||
| 4.2 Gestaltungsbereiche | 306 | ||
| 5. Klassifikation von Geschäftsbeziehungen als Gestaltungshilfe | 308 | ||
| Literatur | 311 | ||
| Wilhelm Bierfelder: “New Age” als Kraftquelle für müde Manager? | 313 | ||
| 1. Beobachtungen für Nachdenkliche | 313 | ||
| 2. Fallstudie einer Legendenbildung | 314 | ||
| 3. Mehr als ein Wandel: die Zeitenwende | 315 | ||
| 4. Technischer Wandel: eine Faktenanalyse | 316 | ||
| 5. Informationstechnik als Trendverstärker | 317 | ||
| 6. Perspektiven des technischen und sozialen Wandels | 318 | ||
| 7. Technologiefolgenabschätzung mit den Maßstäben von gestern | 319 | ||
| 8. Acht und Bann über die Informationstechnik | 320 | ||
| 9. Auf dem Weg in kulturelle “Isolationshaft” im Geschäftsleben? | 320 | ||
| Literatur | 322 | ||
| Herbert Wiedemann: Die Arbeitsfreude in den Spannungsfeldern unternehmenspolitischer Herausforderungen | 323 | ||
| I. Einleitung | 323 | ||
| 1. Arbeitsfreude als ethische Forderung | 323 | ||
| 2. Die unternehmenspolitischen Herausforderungen sind dialektischer Natur | 324 | ||
| II. Die Spannungsfelder vom dialektischen Modell her betrachtet | 325 | ||
| 1. Gesellschaftliche Perspektive: Die Spannung zwischen ökonomischen und sozialen Zielen | 325 | ||
| 2. Organisatorische Perspektive: | 327 | ||
| 2.1 Die Spannung zwischen hierarchischer und netzwerkartiger Organisation | 327 | ||
| 2.2 Die Spannung zwischen Planung und ungeplanten Einwirkungen | 329 | ||
| 3. Beziehungs-Perspektive: | 330 | ||
| 3.1 Potentielle Spannungen zwischen Führungskraft und Mitarbeitern | 331 | ||
| 3.2 Die Spannung zwischen Kooperation und innerbetrieblichem Wettbewerb | 331 | ||
| 4. Gruppen-Perspektive: Die Spannung zwischen rasch entstehendem Ungleichgewicht und der Regulierung zu einem neuen Gleichgewicht hin | 333 | ||
| 5. Rollen-Perspektive: Die Spannung zwischen Arbeitnehmer und Sub-Unternehmer-Haltung | 335 | ||
| 6. Personen-bezogene Perspektive: Die Spannung zwischen Geld-Verdienen-Wollen und Persönlichkeitsentwicklung | 338 | ||
| III. “Führung auf Distanz” als Weg zur Synthese und zur Erlangung der Arbeitsfreude | 340 | ||
| Literatur | 342 | ||
| Autorenverzeichnis | 343 |
