Planung und Rechnungswesen in der Betriebswirtschaftslehre
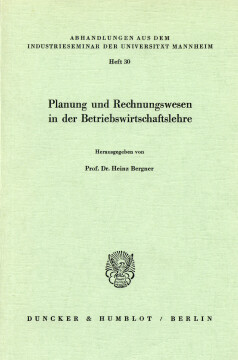
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Planung und Rechnungswesen in der Betriebswirtschaftslehre
Festgabe für Gert v. Kortzfleisch zum 60. Geburtstag
Editors: Bergner, Heinz
Abhandlungen aus dem Industrieseminar der Universität Mannheim, Vol. 30
(1981)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhalt | 5 | ||
| Heinz Bergner: Gert von Kortzfleisch | 7 | ||
| A. | 7 | ||
| B. | 9 | ||
| C. | 10 | ||
| Planung in der Betriebswirtschaftslehre | 17 | ||
| Heiner Müller-Merbach: Die Konstruktion von Input-Output-Modellen | 19 | ||
| A. Input-Output-Modelle in der Produktionstheorie | 19 | ||
| B. Das Grundschema von Input-Output-Prozessen und von deren Modellen | 23 | ||
| C. Elementare Input-Output-Prozesse und ihre Modellierung | 29 | ||
| I. Elementare Input-Output-Prozesse mit Input-seitig oder Output-seitig definierten inneren Mengenströmen | 30 | ||
| 1. Der elementare Input-Output-Prozeß vom Typ F : Ο (Beispiel: Starre Kuppelproduktion) | 32 | ||
| a) Ein Zahlenbeispiel für den Typ F : Ο | 32 | ||
| b) Das Mengenmodell für das Zahlenbeispiel | 33 | ||
| c) Die Mengenrechnung am Zahlenbeispiel | 33 | ||
| d) Die allgemeine Formulierung des Mengenmodells für den Typ F : Ο | 34 | ||
| e) Mengenrestriktionen | 34 | ||
| f) Das Erlösmodell für das Zahlenbeispiel | 35 | ||
| g) Die Erlösrechnung am Zahlenbeispiel | 35 | ||
| h) Die allgemeine Formulierung des Erlösmodells für den Typ F : Ο | 36 | ||
| i) Erlösanforderungen | 36 | ||
| j) Charakteristische Fälle des Typs F : Ο aus der Wirtschaftspraxis | 36 | ||
| k) Die Behandlung des Typs F : Ο in der Produktionstheorie | 38 | ||
| l) Zusammenfassende Aussagen zum Typ F : Ο | 39 | ||
| 2. Der elementare Input-Output-Prozeß vom Typ Ο : F (Beispiel: Starre Mischrezepturen, Stücklisten) | 39 | ||
| a) Ein Zahlenbeispiel für den Typ Ο : F | 39 | ||
| b) Das Mengenmodell für das Zahlenbeispiel | 40 | ||
| c) Die Mengenrechnung am Zahlenbeispiel | 40 | ||
| d) Die allgemeine Formulierung des Mengenmodells für den Typ Ο : F | 41 | ||
| e) Mengenrestriktionen | 41 | ||
| f) Das Kostenmodell für das Zahlenbeispiel | 42 | ||
| g) Die Kostenrechnung am Zahlenbeispiel | 42 | ||
| h) Die allgemeine Formulierung des Kostenmodells für den Typ Ο : F | 42 | ||
| i) Kostenbegrenzungen | 43 | ||
| j) Charakteristische Fälle des Typs Ο : F aus der Wirtschaftspraxis | 43 | ||
| k) Die Behandlung des Typs Ο : F in der Produktionstheorie | 44 | ||
| l) Zusammenfassende Aussagen zum Typ Ο : F | 45 | ||
| II. Elementare Input-Output-Prozesse mit weder Input-seitig noch Output-seitig definierten inneren Mengenströmen | 45 | ||
| 1. Der elementare Input-Output-Prozeß vom Typ Ο : Ο (Beispiel: Transportprobleme) | 46 | ||
| a) Ein Zahlenbeispiel für den Typ Ο : Ο | 46 | ||
| b) Das Mengenmodell für das Zahlenbeispiel | 47 | ||
| c) Die Mengenrechnung am Zahlenbeispiel | 47 | ||
| d) Die allgemeine Formulierung des Mengenmodells für den Typ Ο : Ο | 48 | ||
| e) Mengenrestriktionen | 48 | ||
| f) Das Wertmodell für das Zahlenbeispiel | 49 | ||
| g) Die Wertrechnung am Zahlenbeispiel | 49 | ||
| h) Die allgemeine Formulierung des Wertmodells für den Typ Ο : Ο | 50 | ||
| i) Wertbeschränkungen | 50 | ||
| j) Charakteristische Fälle des Typs Ο : Ο aus der Wirtschaftspraxis | 51 | ||
| k) Die Behandlung des Typs Ο : Ο in der Produktionstheorie | 52 | ||
| l) Zusammenfassende Aussagen | 52 | ||
| 2. Der elementare Input-Output-Prozeß vom Typ V : Ο (Beispiel: Elastische Kuppelproduktion) | 53 | ||
| a) Ein Zahlenbeispiel für den Typ V : Ο | 53 | ||
| b) Das Mengenmodell für das Zahlenbeispiel | 54 | ||
| c) Die Mengenrechnung am Zahlenbeispiel | 54 | ||
| d) Die allgemeine Formulierung des Mengenmodells für den Typ V : Ο | 55 | ||
| e) Mengenrestriktionen | 55 | ||
| f bis i) Das Wertmodell für den Typ V : Ο | 56 | ||
| j) Charakteristische Fälle des Typs V : Ο aus der Wirtschaftspraxis | 56 | ||
| k) Die Behandlung des Typs V : Ο in der Produktionstheorie | 56 | ||
| l) Zusammenfassende Aussagen | 57 | ||
| 3. Der elementare Input-Output-Prozeß vom Typ Ο : V (Beispiel: Elastische Mischrezepturen) | 57 | ||
| a) Ein Zahlenbeispiel für den Typ Ο : V | 58 | ||
| b) Das Mengenmodell für das Zahlenbeispiel | 58 | ||
| c) Die Mengenrechnung am Zahlenbeispiel | 59 | ||
| d) Die allgemeine Formulierung des Mengenmodells für den Typ Ο : V | 60 | ||
| e) Mengenrestriktionen | 61 | ||
| f bis i) Das Wertmodell für den Typ Ο : V | 61 | ||
| j) Charakteristische Fälle des Typs Ο : V aus der Wirtschaftspraxis | 61 | ||
| k) Die Behandlung des Typs Ο : V in der Produktionstheorie | 62 | ||
| l) Zusammenfassende Aussagen | 63 | ||
| III. Der elementare Input-Output-Prozeß vom Typ Ο : V Input-Stoff und/oder Output-Stoff | 63 | ||
| IV. Zusammenfassung zu den elementaren Input-Output-Prozessen | 65 | ||
| D. Kombinative Input-Output-Prozesse und ihre Modellierung | 65 | ||
| I. Der kombinative Input-Output-Prozeß vom Typ CF : Ο (Beispiel: Verschnittprobleme) | 66 | ||
| a) Ein Zahlenbeispiel für den Typ CF : Ο | 66 | ||
| b) Das Mengenmodell für das Zahlenbeispiel für den Typ CF : Ο | 68 | ||
| c) Die Mengenrechnung am Zahlenbeispiel | 69 | ||
| d) Die allgemeine Formulierung des Mengenmodells für den Typ CF : Ο | 69 | ||
| e) Mengenrestriktionen | 70 | ||
| f) Das Wertmodell für das Zahlenbeispiel | 70 | ||
| g) Die Wertrechnung am Zahlenbeispiel | 71 | ||
| h) Die allgemeine Formulierung des Wertmodells für den Typ CF : Ο | 71 | ||
| i) Wertbegrenzungen | 72 | ||
| j) Charakteristische Fälle des Typs CF : Ο aus der Wirtschaftspraxis | 72 | ||
| k) Die Behandlung des Typs CF : Ο in der Produktionstheorie | 74 | ||
| l) Zusammenfassende Aussagen | 75 | ||
| II. Der kombinative Input-Output-Prozeß vom Typ Ο : CF (Beispiel: Kombination von Fertigungsverfahren) | 76 | ||
| a) Ein Zahlenbeispiel für den Typ Ο : CF | 76 | ||
| b) Das Mengenmodell für das Zahlenbeispiel | 77 | ||
| c) Die Mengenrechnung am Zahlenbeispiel | 78 | ||
| d) Die allgemeine Formulierung des Mengenmodells für den Typ Ο : CF | 78 | ||
| e) Mengenrestriktionen | 79 | ||
| f) Das Wertmodell für das Zahlenbeispiel | 79 | ||
| g) Die Wertrechnung am Zahlenbeispiel | 80 | ||
| h) Die allgemeine Formulierung des Wertmodells | 80 | ||
| i) Wertbegrenzungen | 81 | ||
| j) Charakteristische Fälle des Typs Ο : CF aus der Wirtschaftspraxis | 81 | ||
| k) Die Behandlung des Typs Ο : CF in der Produktionstheorie | 82 | ||
| l) Zusammenfassende Aussagen | 82 | ||
| E. Mehrstufige, gemischttypige, zyklische und nichtlineare Input-Output-Prozesse | 83 | ||
| I. Mechanische Fertigung und Stücklisten-Strukturen | 84 | ||
| II. Ein mehrstufiger chemischer Produktionsprozeß mit Zyklus | 87 | ||
| III. Ein Kuppelproduktionsprozeß | 90 | ||
| IV. Produktionsfunktion für Makro-Betrachtungen | 94 | ||
| V. Die Verknüpfung volkswirtschaftlicher Sektoren durch Input-Output-Modelle nach Leontief | 96 | ||
| 1. Das Input-Output-Modell auf der Basis einer konstanten Input-Technologie | 97 | ||
| 2. Das Input-Output-Modell auf der Basis einer konstanten Output-Technologie | 100 | ||
| 3. Zusammenfassender Vergleich von konstanter Input-Technologie und konstanter Output-Technologie | 104 | ||
| VI. Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung | 104 | ||
| F. Die Verbindung von Repetierfaktoren und Potentialfaktoren in Input-Output-Prozessen und ihre Modellierung | 107 | ||
| I. Die gleichartige Behandlung von Potentialfaktoren und Repetierfaktoren | 107 | ||
| II. Die Behandlung von Potentialfaktoren als Begrenzungen von Mengenströmen | 109 | ||
| G. Empfehlungen zur Vorgehensweise bei der Modellierung von Input-Output-Prozessen | 110 | ||
| Franz Steffens: Bausteine dynamischer Produktionssysteme | 115 | ||
| A. Einleitung | 115 | ||
| B. Prozeß und Bestandsentwicklung | 119 | ||
| C. Punktproduktion und räumlich verteilte Produktion | 124 | ||
| D. Dynamisches Produktionssystem | 139 | ||
| Zusammenfassung | 143 | ||
| Literatur | 144 | ||
| Erich Zahn: Entwicklungstendenzen und Problemfelder der strategischen Planung | 145 | ||
| A. Allgemeine Entwicklungstendenzen | 145 | ||
| I. Zum Wesen der strategischen Planung | 145 | ||
| II. Zum Wandel der strategischen Planung | 148 | ||
| III. Zur Wertschätzung der strategischen Planung | 152 | ||
| B. Ausgewählte Problemfelder | 156 | ||
| I. Rationalität und Planung | 157 | ||
| II. Problemfelder im Planungssystem | 161 | ||
| 1. Bereiche des strategischen Planungssystems i. w. S. | 162 | ||
| 2. Bereiche des strategischen Planungssystems i. e. S. | 170 | ||
| ΙII. Problemfelder im Planungsprozeß | 176 | ||
| 1. Umweltanalyse | 179 | ||
| 2. Strategieentwicklung | 183 | ||
| Literaturverzeichnis | 187 | ||
| Hermann Krallmann: Strategische Entscheidungsunterstützungssysteme im Unternehmen | 191 | ||
| A. Einführung | 191 | ||
| B. Notwendigkeit eines EUS | 192 | ||
| I. Unternehmensexterne Charakteristika | 192 | ||
| 1. Komplexität | 192 | ||
| 2. Diskontinuität | 193 | ||
| 3. Exponentialität | 193 | ||
| II. Unternehmensinterne Charakteristika | 193 | ||
| 1. Organisatorische Schwerfälligkeit | 193 | ||
| 2. „Menschlicher" Engpaß | 194 | ||
| 3. Entscheidungskomplexität | 194 | ||
| III. Integrationsaspekte und Konsequenzen | 195 | ||
| C. Anforderungen an ein EUS | 196 | ||
| I. Software-Entwurf | 196 | ||
| 1. Strukturierungsprinzipien | 196 | ||
| 2. Softwarequalität | 198 | ||
| II. Operationalität und Praktikabilität | 199 | ||
| 1. Flexibilität | 199 | ||
| 2. Transparenz und Akzeptanz | 200 | ||
| 3. Rechner gestützte Methoden- und Datenintegration | 200 | ||
| 4. Ergebnisgeneratoren | 200 | ||
| III. Endbenutzerfreundlichkeit | 201 | ||
| 1. Kommando- und Planungssprachen | 201 | ||
| 2. Endbenutzerbedienung | 202 | ||
| D. Gestaltung eines EUS | 203 | ||
| I. Bausteine | 203 | ||
| 1. Datenbanksysteme | 203 | ||
| a) Datenablauforganisation | 204 | ||
| b) Trends der DB-Entwicklung | 206 | ||
| 2. Methoden-/Modellbanksysteme | 207 | ||
| II. Integrationskonzept | 210 | ||
| E. Implementierung eines EUS | 211 | ||
| I. Beschreibung des Praxisprojektes | 211 | ||
| 1. Einführung | 211 | ||
| 2. Darstellung der Problemsituation | 212 | ||
| 3. Istanalyse | 213 | ||
| 4. Modellbeschreibung | 214 | ||
| 5. Modellanwendung | 216 | ||
| 6. Ergebnisse | 218 | ||
| II. Fazit | 219 | ||
| Literaturverzeichnis | 220 | ||
| Günther Schanz: Individuelle Freiheit und Strukturplanung in Wirtschaftsorganisationen | 223 | ||
| A. Hinleitung: Freiheit als menschlicher Grundwert | 223 | ||
| B. Strukturelle Regelungen und Freiheit in der Arbeitswelt | 224 | ||
| I. Kanalisationsinstrumente: Strukturelle Regelungen aus organisationaler Sicht | 224 | ||
| II. Optionen und Ligaturen: Strukturelle Regelungen als Wahlmöglichkeiten und Bezugspunkte | 225 | ||
| C. Grundzüge eines Menschenbildes | 227 | ||
| I. Beweggründe menschlichen Verhaltens: Anmerkungen zum Bedürfnisproblem | 227 | ||
| II. Die Rolle der verhaltensrelevanten Umwelt: Anmerkungen zum Erwartungsproblem | 228 | ||
| D. Konsequenzen für das geplante Objekt | 229 | ||
| I. Zwei Forderungen an eine „vernünftige" Gestaltungsstrategie | 230 | ||
| II. Aufforderung zur aktiven Suche nach Gestaltungsspielräumen: Die individualisierte Organisation | 231 | ||
| E. Individualisierung am praktischen Beispiel: Alternative Arbeitszeitstrukturen | 232 | ||
| I. Individuelle und organisationale Aspekte von Zeitsouveränität | 233 | ||
| II. Die Arbeitszeit als Gegenstand der Strukturplanung: Modelle im Überblick | 235 | ||
| 1. Gestaltung der täglichen Arbeitszeit | 235 | ||
| 2. Gestaltung der wöchentlichen Arbeitszeit | 236 | ||
| 3. Gestaltung der jährlichen Arbeitszeit | 237 | ||
| 4. Gestaltung der Lebensarbeitszeit | 238 | ||
| 5. Stellenaufteilung | 240 | ||
| 6. Schlußbemerkungen | 241 | ||
| Richard Köhler: Unternehmenssituation, Organisationsstruktur und Planungsverhalten Dargestellt am Beispiel des betrieblichen Absatzbereiches | 243 | ||
| A. Wechselbeziehungen zwischen Organisation und Planung | 243 | ||
| I. Grundzüge des kontingenztheoretischen Ansatzes | 243 | ||
| II. Planungsverhalten als abhängige Variable bzw. als Einflußfaktor | 246 | ||
| Β. Aktuelle Organisationsformen im betrieblichen Absatzbereich und ihre konzeptionelle Begründung | 248 | ||
| I. Produkt-Management | 249 | ||
| II. Kunden(gruppen)- bzw. Markt-Management | 251 | ||
| IIΙ. Absatzwirtschaftliches Projekt-Management | 254 | ||
| IV. Die Verknüpfung objekt- und funktionsorientierter Zuständigkeiten in Form der Matrix- oder Tensor organisation | 255 | ||
| C. Kontingenztheoretische Untersuchungen über Situations- und Organisationseinflüsse auf die (absatzwirtschaftliche) Planungstätigkeit | 257 | ||
| I. Der allgemeine Schwerpunkt empirischer Untersuchungen auf der Grundlage des situativen Ansatzes | 257 | ||
| II. Speziellere Studien zur Beziehung zwischen Unternehmenssituation bzw. Organisationsstruktur und Unternehmensplanung | 260 | ||
| III. Ansätze zur bereichsspezifischen Analyse des Zusammenhanges zwischen Absatzbedingungen, Absatzorganisation und Absatzplanung | 264 | ||
| 1. Einsatzbedingungen und Planungsrelevanz des Produkt-Managements | 266 | ||
| 2. Zur Auswirkung des Kunden(gruppen)- bzw. Markt-Managements auf die absatzwirtschaftliche Planung | 272 | ||
| 3. Mögliche Planungskonsequenzen des absatzwirtschaftlichen Projekt-Managements | 274 | ||
| 4. Zur Planung in der Matrix- oder Tensororganisation | 275 | ||
| D. Zusammenfassung | 276 | ||
| Zitierte Literaturquellen | 277 | ||
| Karl Oettle: Grenzen der erwerbs wirtschaftlichen und der öffentlich-wirtschaftlichen Planung | 283 | ||
| A. Absicht der Arbeit; erste Annäherung an den Gegenstand | 283 | ||
| B. Gemeinsame praktische Denkweisen der technischen und der ökonomischen Planung | 285 | ||
| C. Unterschiedliche Inhalte der technischen und der ökonomischen Planung | 287 | ||
| D. Sachgerechte und nicht-sachgerechte Aufgaben der wirtschaftlichen Planung | 290 | ||
| E. Arten planender wirtschaftlicher Gebilde; Arten von Grenzen der wirtschaftlichen Planung | 293 | ||
| F. Außerökonomische Grenzen der wirtschaftlichen Planung | 294 | ||
| G. Individuelle immanente Grenzen der wirtschaftlichen Planung | 297 | ||
| H. Prinzipielle immanente Grenzen der wirtschaftlichen Planung | 299 | ||
| I. Gegenstandsbedingte „Planungswiderstände" in der Erwerbswirtschaft und in der öffentlichen Wirtschaft | 304 | ||
| Rechnungswesen in der Betriebswirtschaftslehre | 309 | ||
| Walther Busse von Colbe: Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Konzernunternehmen nach dem Zeitbezug oder zum Stichtagekurs? | 311 | ||
| A. Problemstellung | 311 | ||
| B. Gegenwärtige Praxis | 312 | ||
| C. Auswirkungen des FAS No. 8 | 315 | ||
| D. Die Änderungsvorschläge in der Literatur zum FAS No. 8 | 319 | ||
| E. FASB- und ASC-Exposure Drafts von 1980 | 322 | ||
| F. Zusammenfassende Beurteilung | 326 | ||
| Klaus Stüdemann: Der Einfluß der Finanzierung auf den Unternehmenswert als Problem der entscheidungsorientierten und der älteren Betriebewirtschaftslehre | 331 | ||
| A. Die der Untersuchung zugrundeliegende Ausgangssituation | 331 | ||
| I. Die zu erörternden Fragen | 331 | ||
| II. Die Unternehmensbewertung als Aufgabe der entscheidungsorientierten und der älteren Betriebswirtschaftslehre | 332 | ||
| B. Der Einfluß des Fremdkapitals auf den Unternehmenswert als Problem der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre | 335 | ||
| I. Die Ermittlung des Unternehmenswertes | 335 | ||
| 1. Die Ermittlung des Unternehmenswertes in Form des Gesamtkapitalwertes GKW | 335 | ||
| a) Die Bedeutung der Substanz für die Bewertung im Sinne der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre | 335 | ||
| b) Die Rechnung mit dem Eigenkapitalwert EKW | 338 | ||
| c) Die Rechnung mit dem Eigenkapitalwert EKW | 342 | ||
| 2. Die Ermittlung des Unternehmenswertes in Form des Eigenkapitalwertes EKW2 | 342 | ||
| II. Die Ermittlung des Finanzierungswertes | 345 | ||
| C. Der Einfluß des Fremdkapitals auf den Unternehmenswert als Problem der älteren Betriebswirtschaftslehre | 348 | ||
| I. Die Bedeutung des Substanzwertes für die Unternehmensbewertung | 348 | ||
| 1. Die Bedeutung des Substanzwertes für die Unternehmensbewertung in der Praxis | 348 | ||
| 2. Die Bedeutung des Substanzwertes für die Unternehmensbewertung in der Theorie | 352 | ||
| II. Die Bedeutung des Fremdkapitals für die Bestimmung des Substanzwertes | 354 | ||
| 1. Die Vorteilhaftigkeitsgröße als Bestandteil des Geschäftswertes | 354 | ||
| 2. Die Vorteilhaftigkeitsgröße als Bestandteil des Substanzwertes | 357 | ||
| a) Der rechnerische Ausweis der Vorteilhaftigkeitsgröße als Bestandteil des Substanzwertes | 357 | ||
| b) Die Gründe für den rechnerischen Ausweis der Vorteilhaftigkeitsgröße als Bestandteil des Substanzwertes | 362 | ||
| aa) Die Behandlung der kapitalisierten Vorteilhaftigkeitsgröße als Disagio | 362 | ||
| bb) Die Abschreibungsfähigkeit der Vorteilhaftigkeitsgröße | 363 | ||
| cc) Die Ausschaltung von Finanzierungseinflüssen aus dem Geschäftswert mit Hilfe der Vorteilhaftigkeitsgröße | 363 | ||
| α) Die Ausschaltung von Finanzierungseinflüssen im allgemeinen | 363 | ||
| β) Die Ausschaltung der Folgen fehlerhafter Finanzierung im besonderen | 364 | ||
| dd) Die Berücksichtigung der Kreditlaufzeit mit Hilfe der Vorteilhaftigkeitsgröße | 364 | ||
| ee) Die Bedeutung der Vorteilhaftigkeitsgröße für das Stuttgarter Verfahren | 365 | ||
| D. Ausblick | 370 | ||
| Definitionstabelle | 372 | ||
| a) Kapital- und Substanzformen | 372 | ||
| b) Werte | 373 | ||
| c) Zinsen | 373 | ||
| d) Sonstiges | 374 | ||
| Wertetabelle | 374 | ||
| Literaturverzeichnis | 375 | ||
| Otto H. Jacobs: Entnahmefähiger Gewinn und Unternehmensbewertung in Zeiten steigender Preise | 379 | ||
| A. Problemstellung | 379 | ||
| Β. Zum gegenwärtigen Stand der Diskussion um die Unternehmensbewertung | 380 | ||
| I. Der Ertragswert als maßgeblicher Wert von fortzuführenden Unternehmen | 380 | ||
| II. Die Antinomie zwischen subjektiver und objektivierter Betrachtungsweise bei der Ertragswertermittlung | 381 | ||
| ΙII. Auflösung des Konfliktes: Die funktionale Betrachtungsweise | 382 | ||
| C. Die Bestimmungsgrößen des Ertragswertes | 388 | ||
| I. Diskontierte Nettoeinnahmen oder Ertragsüberschüsse? | 388 | ||
| II. Die Vollausschüttungsthese | 391 | ||
| D. Die Wirkung von Preissteigerungen auf die Komponenten des Ertragswertes | 393 | ||
| I. Die Bedeutung der unterstellten Erhaltungskonzeption für den entnahmefähigen Gewinn | 393 | ||
| II. Substanzerhaltungsrechnungen als Brutto- oder Nettorechnungen | 397 | ||
| III. Konsequenzen für die funktionale Unternehmensbewertung | 400 | ||
| Heinz Bergner: Zum Modellcharakter des Kontenrahmens | 407 | ||
| A. Kontenrahmen als betriebswirtschaftliche Ermittlungsmodelle | 407 | ||
| B. Betriebswirtschaftliche Modellarten und Kontenrahmen oder kontenrahmenbegleitende Darstellungen | 408 | ||
| I. Wortsprachliche Modelle | 408 | ||
| II. Formale Modelle | 409 | ||
| IIΙ. Graphische Modelle | 409 | ||
| 1. Graphisch-ikonische Modelle | 409 | ||
| 2. Graphisch-abstrakte Modelle | 411 | ||
| a) Tabellen | 411 | ||
| b) Schaubilder | 413 | ||
| aa) Statistische Diagramme | 413 | ||
| bb) Freie Diagramme | 413 | ||
| cc) Graphendiagramme | 414 | ||
| α) Funktionsgraphen | 414 | ||
| β) Strukturgraphen | 414 | ||
| IV. Plastische Modelle | 416 | ||
| 1. Plastisch-ikonische Modelle | 417 | ||
| a) Erkenntnismodelle | 417 | ||
| b) Nachformmodelle | 417 | ||
| 2. Plastisch-abstrakte Modelle | 417 | ||
| C. Das Modell als Abbild oder Vorbild | 418 | ||
| D. Das Original als Vorlage | 419 | ||
| I. Das Problem der Wirklichkeit | 420 | ||
| II. Erscheinungsformen des Originals | 422 | ||
| E. Das Gefüge von Modellbeziehungen beim Kontenrahmen | 423 | ||
| I. Longerale Modellbeziehungen | 423 | ||
| 1. Modelle vor Schmalenbach | 423 | ||
| 2. Schmaleribachs Kontenrahmenmodell von 1927 und darauf aufbauende Modelle | 425 | ||
| II. Laterale Modellbeziehungen | 428 | ||
| III. Alterale Modellbeziehungen | 429 | ||
| 1. Die Vertiefung des Kontenrahmenmodells durch das Kontenplanmodell | 429 | ||
| 2. Die von den Kontenrahmen gewährten Vertiefungsmaße | 429 | ||
| a) Die Zuordnung der Buchhaltungsbereiche zu Kontenklassen als Folge des vorgegebenen Buchungskreissystems | 429 | ||
| b) Die Freiheitsmaße bei der Untergliederung der Kontenklassen | 431 | ||
| c) Die Freiheitsmaße bei der Ausgestaltung der Betriebsbuchhaltung | 432 | ||
| aa) Die Modelle von Schmalenbach bis zum Gemeinschafts-Kontenrahmen | 432 | ||
| bb) Die Kosten- und Leistungsrechnung im Industrie-Kontenrahmen | 434 | ||
| F. Schaubildmodelle des Industrie-Kontenrahmens | 438 | ||
| I. Kontenschaubild 1: Modell Industrie-Kontenrahmen (IKR) Geschäftsbuchführung | 440 | ||
| II. Kontenschaubild 2: Modell Industrie-Kontenrahmen (IKR) Kosten- und Leistungsrechnung in Kontenklasse 9 Istkostenrechnung zu Vollkosten | 445 | ||
| III. Kontenschaubild 3: Modell Industrie-Kontenrahmen (IKR) Kosten- und Leistungsrechnung in Kontenklasse 9 Grenzplankostenrechnung | 450 | ||
| Bibliographie | 455 | ||
| Verzeichnis der Veröffentlichungen von Gert von Kortzfleisch | 457 | ||
| I. Selbständige Schriften | 457 | ||
| II. Aufsätze in Zeitsdiriften und Sammelwerken | 457 | ||
| III. Artikel in Handwörterbüchern und Nachschlagewerken | 461 | ||
| IV. Herausgeber und Mitherausgeber | 461 | ||
| Verzeichnis der Mitarbeiter | 463 |
