Konjunktur und Neoklassik
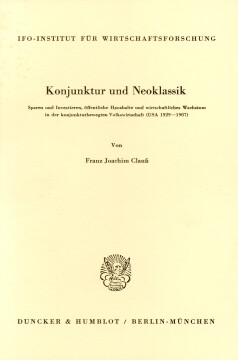
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Konjunktur und Neoklassik
Sparen und Investieren, öffentliche Haushalte und wirtschaftliches Wachstum in der konjunkturbewegten Volkswirtschaft (USA 1929-1967)
Schriftenreihe des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Vol. 69
(1968)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Tabellenverzeichnis | 14 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 16 | ||
| Einleitung und Inhaltsübersicht | 17 | ||
| A. Konjunktur und Saldenmechanik | 33 | ||
| I. Ein Generalthema der Nationalökonomie | 33 | ||
| 1. Die Sonderstellung der fiskalischen Probleme: | 34 | ||
| Antagonismus zwischen individual- und sozialökonomischem Denken | 34 | ||
| 2. Zwischenbemerkungen gegen mögliche Mißverständnisse | 36 | ||
| Keine leichtfertige Negation konservativer Finanzpolitik | 36 | ||
| Kein Antagonismus zwischen betriebs- und volkswirtschaftlichem Denken | 37 | ||
| Prüffeld USA | 40 | ||
| 3. Zwei Nationalökonomien? | 42 | ||
| 4. Ahnherren des kreislauftheoretischen Denkens | 47 | ||
| Ein noch unverstandener Grundgedanke | 49 | ||
| Die größte Entdeckung der Sozialwissenschaften | 51 | ||
| 5. „Alte" gegen „neue" Wirtschaftslehre? | 52 | ||
| Die neoklassische Kritik... | 54 | ||
| ...und die politische Wirklichkeit | 55 | ||
| 6. Wandel der wirtschaftsdiagnostischen Maßstäbe | 58 | ||
| Prosperität ist wirtschaftliches Wachstum | 62 | ||
| Bewußtseinswandel sogar in Großbritannien | 65 | ||
| II. Die öffentlichen Haushalte in ihrer Abhängigkeit von der konjunkturellen Saldenmechanik | 68 | ||
| 1. Die Entwicklung der öffentlichen Haushalte in den Vereinigten Staaten nach dem Verwaltungsbudget | 69 | ||
| 2. Die vier Sektoren der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung | 74 | ||
| 3. Sparen gleich Investieren? | 79 | ||
| Ein scholastischer Streitpunkt... | 81 | ||
| ...aufgrund unklarer Begriffsbildung | 83 | ||
| 4. Die deflatorische Abnormität: Die Saldenkonstellation in den dreißiger Jahren | 88 | ||
| Substanzverzehr einer Volkswirtschaft | 89 | ||
| Allgemeine Folgerungen aus der deflatorischen Situation: Haushaltsausgleich als Utopie | 91 | ||
| 5. Die Dimension des Abnormen: Daten zur Weltwirtschaftskrise | 95 | ||
| 6. Die inflatorische Abnormität: Kriegsbedingt hohe EinnahmenÜberschüsse im privaten und Defizite im öffentlichen Sektor | 97 | ||
| 7. Der „strukturelle" Unterschied zwischen Vor- und Nachkriegszeit | 101 | ||
| 8. Die konjunkturelle Saldenmechanik in der Nachkriegszeit | 104 | ||
| Konjunkturneurotische Selbstfinanzierungs-Quote | 105 | ||
| „Konjunkturmotor" sind auch die Konsumenten-Investitionen | 108 | ||
| Unsichere „Konjunkturmotoren" | 111 | ||
| Die Schwankungen der Gesamtinvestitionen machen das Konjunkturphänomen aus | 114 | ||
| Sparen und Investieren im Konjunkturverlauf | 118 | ||
| 9. Typologie und Häufigkeit der Salden-Konstellationen | 121 | ||
| Zwischenbemerkung zum Problem der statistischen Erfassung der Saldenkonstellationen | 125 | ||
| Zwei Haupttypen von Saldenkonstellationen | 127 | ||
| Ausgaben-Inflation verhinderte nicht öffentliche Haushalts-Überschüsse | 128 | ||
| Sparsamkeit konnte Defizite nicht verhindern | 129 | ||
| Gleiche Saldenkonstellation in Inflation und Deflation | 131 | ||
| Zusammenfassung: „Gleichgewicht zwischen Sparen und Investieren" war auch in der Nachkriegszeit immer Ausnahmeerscheinimg | 133 | ||
| Analoge Entwicklung in der Bundesrepublik in jüngster Zeit | 137 | ||
| III. Konjunkturelle Saldenmechanik und Fiskalpolitik | 139 | ||
| 1. Die außergewöhnliche Entwicklung in den „goldenen Sechzigern" | 140 | ||
| 2. Die Steuersenkungs-Frage als ein Kernproblem der antizyklischen Fiskalpolitik | 143 | ||
| Die Problematik einer prophylaktischen Konjunkturpolitik | 146 | ||
| Der Einfluß der Konzeption einer zahlungsbilanzkonformen Wirtschaftspolitik und der „neuen Wirtschaftslehre" | 150 | ||
| Das Problem der „chronischen" Haushaltsdefizite | 154 | ||
| 3. Die Rechtfertigung der Steuersenkung als „strukturpolitische" Maßnahme | 155 | ||
| Prozyklische Finanzpolitik... | 157 | ||
| ...oder Anwendung des Beschäftigungsgesetzes? | 162 | ||
| 4. Die Rolle der nachfragebedingten „Produktivitäts"-Lücke in der fiskalpolitischen Frage | 165 | ||
| Die Unterschätzung des Wachstumspotentials einer hochentwickelten Volkswirtschaft durch amerikanische Sachverständige | 166 | ||
| Die entscheidende Bedeutung der Konjunkturfaktoren | 170 | ||
| Die wissenschaftslogische Problematik der Potentialdiagnosen und -Prognosen | 171 | ||
| Der Zusammenhang zwischen Nachfragelücke und Arbeitslosigkeit | 175 | ||
| „Vollbeschäftigungsbudget" | 179 | ||
| 5. Der Einfluß der neueren konjunkturellen Entwicklung in der steuerpolitischen Frage | 182 | ||
| Konjunkturell schwankendes Urteil über die steuerpolitische Frage | 186 | ||
| Ein zu schwerfälliges Instrument | 190 | ||
| Koexistenz von Rezession und Inflation... | 191 | ||
| ...Symptom der Produktivkraft einer hochentwickelten Volkswirtschaft? | 193 | ||
| „Strukturpolitik" als Konjunkturpolitik? | 194 | ||
| 6. Das Problem der „chronischen" Defizite im US-Bundeshaushalt | 196 | ||
| Konjunkturbedingte Tendenz zum Haushaltsausgleich | 196 | ||
| Rekord-Defizite 1967/68: halb inflations-, halb rezessionsbedingt | 199 | ||
| Waren die chronischen Defizite des Bundeshaushalts in den sechziger Jahren durch „Ausgaben-Inflation" bedingt? | 201 | ||
| Zunehmende Spar-Überschüsse „trotz Hochkonjunktur" | 202 | ||
| Die Symptome der jüngsten Geldinflation | 208 | ||
| Öffentliche Defizite bei kontraktiver, Uberschüsse bei expansiver Konjunktur | 210 | ||
| 7. Zusammenfassung: Die Fiskalpolitik hat nur konjunkturpolitische, keine isolierten haushaltspolitischen Alternativen | 212 | ||
| 8. Fazit: Die logisch-saldenmechanische und praktisch-politische Unmöglichkeit der „klassischen Haushaltsmaxime" | 215 | ||
| Fehlende Bestätigung für die Inflationsthese | 215 | ||
| Die Richtigkeit der neoklassischen Konzeption ist nicht nur unbestätigt, sondern prinzipiell unbeweisbar | 220 | ||
| IV. Probleme der „langfristigen" saldenmechanischen Entwicklung und der sogenannten „strukturell fundierten" Fiskalpolitik | 223 | ||
| „Vorläufer" USA | 224 | ||
| Erfahrungsdruck arbeitet für die „neue Wirtschaftslehre"... | 228 | ||
| ...sichert aber nicht gegen Rückfälle | 230 | ||
| 1. Probleme der Beurteilung der längerfristigen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Sparen und Investieren sowie der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben | 235 | ||
| Das Problem der sog. „strukturellen Basis" der Haushaltsplanung | 237 | ||
| Eine moderne fiskalpolitische Konzeption... | 240 | ||
| ...mit kleinen Schönheitsfehlern | 241 | ||
| 2. Das Problem der langfristigen Entwicklungstendenz des statistischen S-I-Saldos | 244 | ||
| Problematische Trend-Diagnose | 244 | ||
| Konjunkturell bedingter Entwicklungstrend | 251 | ||
| Trendprognose als Konjunkturprognose | 256 | ||
| 3. Zur Hypothese einer Tendenz zu „säkularer Stagnation": Gibt es hinreichende empirische Anhaltspunkte, die für oder gegen sie sprechen? | 259 | ||
| Rückblick auf die „Stagnationsthese" | 260 | ||
| War die Stagnationsthese wirklich so abwegig? | 266 | ||
| Die konjunkturbedingte Offenheit des Problems | 271 | ||
| V. „Pieromatische" Grundprobleme | 274 | ||
| 1. Das „Überfluß-Problem" | 274 | ||
| Nationalökonomie einer vergangenen Epoche | 277 | ||
| Armut im Überfluß | 279 | ||
| Verteilungs- und Wachstumsproblem | 284 | ||
| 2. Der verteilungstheoretische Kern der „Fülle-Ökonomie" | 288 | ||
| Die Relativität der pleromatischen Thesen | 290 | ||
| Eskalation des Rassenkampfes demonstriert die Dringlichkeit der Probleme der „Armut im Überfluß" | 294 | ||
| Akademisches Proletariat — proletarische Einkommens-Aristokratie | 304 | ||
| Der kommissarisch anerkannte Kern der pleromatischen Probleme | 308 | ||
| 3. Der entwicklungstheoretische Kern des Problems | 317 | ||
| Eine entwicklungstheoretische Polarität | 319 | ||
| Beschreibungsschema für den „Entwicklungsstatus" | 326 | ||
| Überproduktion als „Widerspruch des Staatskapitalismus"? | 328 | ||
| Entwicklungsprobleme zweier Weltmächte | 331 | ||
| 4. Zusammenfassung: Empirische und „empiristische" Sicht | 337 | ||
| B. Neoklassik und Klassenlogik | 343 | ||
| VI. Konjunktur und „Wachstumstheorie" | 343 | ||
| 1. Die empirische Irrelevanz des neoklassischen Ansatzes | 344 | ||
| Rückfall in Saysche Denkformen? | 345 | ||
| Der neoklassische Denkstil in der Diagnostik | 351 | ||
| Schrumpfende empirische Basis der neoklassischen Konzeption | 356 | ||
| 2. Widersprüche der angewandten Wachstumstheorie | 358 | ||
| Zerlegung der Wachstumsrate | 361 | ||
| Gerechtfertigte Trend- Extrapolation? | 363 | ||
| Technischer oder konjunkturbedingter Fortschritt? | 365 | ||
| Restkomponente als „Konjunktur- Fortschrittskomponente" | 368 | ||
| „Consensus omnium" | 371 | ||
| 3. Schwindende empirische Basis der angebotsorientierten Wachstumstheorie | 376 | ||
| 4. Die „nachfrageorientierte" Wachstumstheorie | 381 | ||
| Angebotsbedingte Wachtumsrate in „nachfrageorientierten" Modellen | 381 | ||
| Hängt der wirtschaftliche Fortschritt von der Sparneigung ab? | 384 | ||
| Gibt es eine „natürliche Fortschrittsrate"? | 387 | ||
| Wachstumsmythos der fünfziger Jahre als Analogie zum Stagnationsmythos der dreißiger Jahre? | 388 | ||
| 5. Synthese: Konjunktur- und Wachstumstheorie als Polarität | 393 | ||
| Wachstumstheorie als Konjunkturtheorie? | 394 | ||
| Ein realistisches, synthetisches Modell | 397 | ||
| Wachstums- und Zyklusmodelle als Grenztypen wirtschaftlicher Verlaufsformen | 400 | ||
| 6. Konvergenzsymptome in empiristischer Prognostik | 402 | ||
| Empirisch orientierte Planifikateure | 403 | ||
| Nachfrageorientierte Input-Output-Analyse | 403 | ||
| Intuition und Expertenmeinung als Prognosehelfer | 405 | ||
| Methodologische Wiedervereinigung in politischer Prognose | 406 | ||
| Das Bessere ist der Feind des Guten | 407 | ||
| VII. Konjunktur und Strukturtheorie | 409 | ||
| 1. Grundprobleme der Quotenstruktur | 409 | ||
| Ein historisches „Gesetz" stetig wachsender öffentlicher Ausgabequoten? | 410 | ||
| Zur Entwicklung der Sozialproduktkomponenten- Struktur in USA seit 1929 | 415 | ||
| Politisch bedingte Niveauerhöhungen der Staatsquote | 418 | ||
| Konjunkturelle Schwankungen der Quotenstruktur | 419 | ||
| Langfristig sinkende statt steigende Staatsquote? | 422 | ||
| Entwicklungsgesetz oder Konjunkturprognose? | 424 | ||
| 2. Die Konjunkturfaktoren in der Quotenmechanik anderer Strukturquoten-Rechnungen | 425 | ||
| Sinkende Dienstleistungsausgaben-Quote? | 425 | ||
| „Konjunkturelle" und „strukturelle" Veränderungen als heuristische Fiktion | 427 | ||
| Sinkt oder steigt „die" Investitionsquote? | 428 | ||
| 3. Antinomien der „reinen strukturtheoretischen Vernunft" | 430 | ||
| Grenzen sinnvoller Spekulation | 431 | ||
| „Strukturgesetze" als Konjunkturprognose | 432 | ||
| VIII. Die konjunktur- und wirtschaftspolitisch bedingte Offenheit des Problems der langfristigen Entwicklung und die ausschlaggebende Rolle der sozialökonomischen Technologie | 434 | ||
| Intuition und Analogie als Vehikel der Vorausschau | 438 | ||
| Lehrbeispiel Bevölkerungprognose | 440 | ||
| Das prognostische Kernproblem: Prognose des „sozialtechnischen" Fortschritts und seines Abstandes vom technischen Fortschritt | 445 | ||
| IX. „Methodenstreit" und Klassenlogik | 449 | ||
| Wandlung des Wissenschaftsbegriffs der Ökonomie? | 450 | ||
| Korrelation und Kausalität | 452 | ||
| Neoklassik und aristotelische Logik | 456 | ||
| Klassenlogische Wurzeln des „neuen Methodenstreits" | 458 | ||
| „Rechnende" und „verstehende", „mathematische" und „dialektische" Ökonomie | 463 | ||
| Sackgasse des Mathematizismus und Physikalismus | 465 | ||
| Literaturverzeichnis | 471 | ||
| Personenregister | 478 | ||
| Sachregister | 480 |
