Arbeitgeberbegriffe und arbeitsrechtlicher Drittbezug
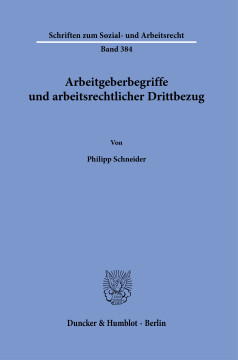
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Arbeitgeberbegriffe und arbeitsrechtlicher Drittbezug
Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht, Vol. 384
(2024)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Der Arbeitgeberbegriff spielt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung kaum eine Rolle. Seine Bedeutung beschränkt sich darauf, die andere Partei des Arbeitsvertrages zu bezeichnen. In dem als Zweipersonenkonstellation konzipierten Arbeitsverhältnis besteht kein Anlass, diese Definition zu hinterfragen. Anders ist dies jedoch in Sachverhalten arbeitsrechtlichen Drittbezugs: In diesen übt ein neben dem Vertragsarbeitgeber stehender Dritter unmittelbar oder mittelbar Arbeitgeberfunktionen aus. Daher haben Literatur und Rechtsprechung andere, vom allgemeinen Verständnis abweichende Definitionen des Arbeitgeberbegriffs entwickelt. Untersucht werden das Individualarbeitsrecht, das kollektive Arbeitsrecht sowie das Internationale Zivilprozess- und Privatrecht. Neben der deutschen Rechtsordnung werden auch das französische, englische und US-amerikanische Recht beleuchtet. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Ansätzen, welche den Arbeitgeberbegriff als rechtliche Grundlage verstehen und aus der Ausübung von Arbeitgeberfunktionen Rechte und Pflichten ableiten.In contrast to two-person constellations, there is reason to question the definition of the term »employer« in cases involving third parties. The third party performs employer functions alongside the contractual employer, which raises the question of how he can be covered by the term »employer«. The various approaches are presented and categorised in the thesis.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsübersicht | 9 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 11 | ||
| Einleitung | 21 | ||
| I. Arbeitgeberbegriffe und arbeitsrechtlicher Drittbezug | 21 | ||
| II. Ziel und Gang der Untersuchung | 22 | ||
| III. Stand der Forschung | 23 | ||
| Kapitel 1: Bestandsaufnahme | 25 | ||
| A. Gang der Untersuchung | 25 | ||
| B. Sachverhalte arbeitsrechtlichen Drittbezugs | 25 | ||
| I. Unmittelbare Einflussnahme auf das Vertragsarbeitsverhältnis | 25 | ||
| 1. Einführung | 25 | ||
| 2. Arbeitnehmerüberlassung | 26 | ||
| 3. Abordnung zu einer Arbeitsgemeinschaft | 27 | ||
| 4. Matrixstrukturen im Konzern oder virtuellen Unternehmen | 29 | ||
| 5. Gesamthafenbetrieb | 29 | ||
| 6. Arbeitgeberzusammenschluss | 30 | ||
| 7. Onsite Dienst- und Werkverträge | 31 | ||
| 8. Plattformarbeit | 33 | ||
| a) Begriffsbestimmungen | 33 | ||
| b) Rechtliche Ausgestaltung | 34 | ||
| c) Rechtlicher Status der Plattformarbeiter | 35 | ||
| d) Vertragsgestaltung und Parteien des Arbeitsvertrages | 38 | ||
| e) Einordnung als arbeitsrechtlicher Drittbezug | 39 | ||
| 9. Zwischenergebnis | 41 | ||
| II. Beeinflussung der Entscheidungen des Vertragsarbeitgebers | 41 | ||
| 1. Arbeitsverhältnis im Konzern | 41 | ||
| 2. Schuldrechtliche Einflussnahmemöglichkeit | 43 | ||
| a) Franchising | 43 | ||
| b) Ausrichtung des Betriebszwecks auf Dritten | 44 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 45 | ||
| III. Kombination von unmittelbarer Einflussnahme und Beeinflussung der Entscheidungen des Vertragsarbeitgebers | 45 | ||
| IV. Zusammenfassung | 46 | ||
| C. Auswirkungen arbeitsrechtlichen Drittbezugs auf das arbeitsrechtliche Rechte- und Pflichtengefüge | 47 | ||
| I. Einführung | 47 | ||
| II. Unmittelbare Einflussnahme auf das Vertragsarbeitsverhältnis | 47 | ||
| III. Beeinflussung der Entscheidungen des Vertragsarbeitgebers | 50 | ||
| IV. Zusammenfassung | 52 | ||
| D. Ergebnis | 52 | ||
| Kapitel 2: Arbeitsrechtliche Bewältigung des Drittbezugs | 54 | ||
| A. Vorgehensweise | 54 | ||
| B. Dritter als Partei des Arbeitsvertrages | 55 | ||
| I. Einführung | 55 | ||
| II. Rechtsgeschäftliche Begründung der Stellung als Partei des Arbeitsvertrages | 56 | ||
| 1. Ausdrücklicher Vertragsschluss | 56 | ||
| 2. Konkludenter Vertragsschluss | 57 | ||
| a) Problemaufriss | 57 | ||
| b) Unmittelbare Inanspruchnahme der Arbeitsleistung | 57 | ||
| aa) Ausübung unmittelbarer Arbeitgeberfunktionen durch den Dritten | 57 | ||
| bb) Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Erbringung der Arbeitsleistung unter Weisungen des Dritt | 59 | ||
| cc) Übertragung des Weisungsrechts an den Dritten | 59 | ||
| dd) Absicherung über das Vertragsarbeitsverhältnis | 60 | ||
| c) Mittelbare Inanspruchnahme der Arbeitsleistung | 60 | ||
| aa) Einflussnahme auf Entscheidungen des Vertragsarbeitgebers | 60 | ||
| bb) Rechtsgeschäftlicher Erklärungstatbestand | 61 | ||
| d) Vertragsschluss infolge eines Vertrauenstatbestandes | 62 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 62 | ||
| III. Gesetzliche Begründung der Stellung als Partei des Arbeitsvertrages | 63 | ||
| 1. Fingiertes Arbeitsverhältnis bei der Arbeitnehmerüberlassung, § 10 Abs. 1 S. 1 AÜG | 63 | ||
| a) Gesetzeswidrige Arbeitnehmerüberlassung, § 9 Abs. 1 Nr. 1–1b AÜG | 63 | ||
| b) Ursprüngliche Konzeption: „Sozialer Schutz“ des Leiharbeitnehmers | 64 | ||
| c) Tatbestandliche Erweiterung durch AÜG-Reform 2017 | 65 | ||
| 2. Übergang der Arbeitsverhältnisse bei einem Betriebsübergang, § 613a Abs. 1 S. 1 BGB | 66 | ||
| 3. Übergang der Arbeitsverhältnisse beim Trägerwechself ür die Leistungen des Sozialgesetzbuch II, § 6c Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 SGB II | 66 | ||
| IV. Arbeitsrechtlicher Rechtsformzwang als Grundlage der Parteistellung | 67 | ||
| 1. Grundsätzliches zum arbeitsrechtlichen Rechtsformzwang | 67 | ||
| 2. Heranziehung in Sachverhalten arbeitsrechtlichen Drittbezugs | 68 | ||
| 3. Rechtsmissbräuchliche Vertragsgestaltung | 69 | ||
| a) Mittelbares Arbeitsverhältnis | 69 | ||
| b) Beschäftigung bei einer Personalführungsgesellschaft | 70 | ||
| c) Bausteine des Vorwurfs der Rechtsmissbräuchlichkeit | 71 | ||
| 4. Anwendung in der Rechtspraxis | 72 | ||
| 5. Zwischenergebnis | 73 | ||
| V. Anspruch auf Abschluss eines Arbeitsvertrages gegen den Dritten | 73 | ||
| 1. Sinngemäße Normanwendung | 73 | ||
| 2. Schadensrechtliche Naturalrestitution | 74 | ||
| 3. Haftung des Dritten als falsus procurator | 76 | ||
| VI. Ergebnis | 76 | ||
| C. Arbeitgeberstellung des Dritten ohne Einbeziehung als Vertragspartei | 77 | ||
| I. Problemaufriss und Vorgehensweise | 77 | ||
| II. Individualarbeitsrecht | 77 | ||
| 1. Gang der Untersuchung | 77 | ||
| 2. Umfassende Einbeziehung in das Rechte- und Pflichtengefüge | 78 | ||
| a) Nichtvertragliche Rechtsbeziehung zum Dritten | 78 | ||
| b) Grundlage der Arbeitgeberstellung: Ausübung des Weisungsrechts | 78 | ||
| c) Zwischenergebnis | 80 | ||
| 3. Gegenständlich begrenzte Arbeitgeberstellung | 81 | ||
| a) Mitarbeitgeberstellung aus dem französischen Konzernarbeitsrecht | 81 | ||
| aa) Grundüberlegung | 81 | ||
| bb) Grundlage der Arbeitgeberstellung: Einmischung in Interessen, Tätigkeit und Geschäftsführung des Vertragsarbeitgebers | 82 | ||
| b) Funktionaler Arbeitgeberbegriff aus der englischen Literatur | 85 | ||
| aa) Konzeption | 85 | ||
| bb) Grundlage der Arbeitgeberstellung: Ausübung von Arbeitgeberfunktionen | 85 | ||
| c) Arbeitgeberstellung für einzelne Gesetzesvorschriften | 86 | ||
| aa) Einführung | 86 | ||
| bb) Haftung des Dritten für Mindestlohn und Überstundenvergütung im Rahmen des US-amerikanischen Fair Labor Standards Act 1938 | 87 | ||
| (1) Reichweite der Haftung | 87 | ||
| (2) Voraussetzungen für Arbeitgeberstellung | 87 | ||
| cc) Verantwortlichkeit für Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften | 90 | ||
| (1) § 2 Abs. 3 ArbSchG | 90 | ||
| (2) § 618 BGB | 91 | ||
| (3) § 62 Abs. 1 HGB | 92 | ||
| (4) Occupational Safety and Health Act 1970 | 92 | ||
| dd) Arbeitnehmererfindungen im Betrieb des Entleihers | 92 | ||
| ee) Arbeitgeberstellung für das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz | 93 | ||
| d) Zwischenergebnis | 94 | ||
| 4. Rangverhältnis zwischen Vertragsarbeitgeber und nichtvertraglichem Arbeitgeber | 94 | ||
| 5. Verwendung des Arbeitsgeberbegriffs zur Erklärung der Ausübung von Arbeitgeberfunktionen | 96 | ||
| 6. Unklare Bedeutung der Arbeitgeberstellung | 97 | ||
| a) Nichtvertragliche Arbeitgeberstellung (Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs) | 97 | ||
| b) Tätigwerden unter den Weisungen des Dritten | 97 | ||
| aa) Anknüpfungspunkt | 97 | ||
| (1) Arbeitgeberstellung im Betriebsübergang | 97 | ||
| (2) Arbeitgeberstellung des Entleihers | 99 | ||
| (3) Arbeitgeberstellung im Rahmen von Art. 13 Abs. 1 lit. b VO Nr. 883/2004 | 100 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 101 | ||
| bb) Rechtsfolgen | 102 | ||
| c) Einflussnahme des Dritten auf Entscheidungen des Vertragsarbeitgebers | 103 | ||
| d) Zwischenergebnis | 104 | ||
| 7. Zusammenfassung und Einordnung der bisherigen Ergebnisse | 104 | ||
| III. Kollektives Arbeitsrecht | 105 | ||
| 1. Gang der Untersuchung | 105 | ||
| 2. Arbeitgeberstellung des Dritten für das Betriebsverfassungsrecht | 105 | ||
| a) Grundsätzliches zum betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitgeberbegriff | 105 | ||
| b) Grundproblematik in Sachverhalten arbeitsrechtlichen Drittbezugs | 107 | ||
| c) Arbeitgeberstellung des Dritten bei Ausübung des Weisungsrechts | 108 | ||
| aa) Anwendung der Zwei-Komponenten-Lehre | 108 | ||
| bb) Gesetzliche Bestimmungen | 109 | ||
| cc) Weiterentwicklung durch Literatur und Rechtsprechung | 111 | ||
| (1) Einführung | 111 | ||
| (2) Beteiligungsrechte des Betriebsrates | 111 | ||
| (a) Soziale Angelegenheiten, § 87 Abs. 1 BetrVG | 111 | ||
| (b) Beschäftigung von Fremdpersonal, § 99 BetrVG | 113 | ||
| (3) Geltung von Betriebsvereinbarungen | 115 | ||
| (4) Verpflichtung des Dritten als Betriebsinhaber | 115 | ||
| (5) Berücksichtigung bei Schwellenwerten | 116 | ||
| (a) Größe der Arbeitnehmervertretung, § 9 S. 1 BetrVG | 116 | ||
| (b) Freistellung von Betriebsratsmitgliedern, § 38 Abs. 1 BetrVG | 117 | ||
| (c) Beteiligungsrechte, § 111 BetrVG | 117 | ||
| (d) Zwischenergebnis | 118 | ||
| (6) Doppelte Betriebszugehörigkeit | 118 | ||
| dd) Zwischenergebnis | 120 | ||
| d) Arbeitgeberstellung des Dritten bei Einflussnahme auf Entscheidungen des Vertragsarbeitgebers | 120 | ||
| aa) Auswirkungen der Einflussnahme auf Beteiligungsrechte des Betriebsrats | 120 | ||
| bb) Schaffung eigener Mitbestimmungsorgane durch den Gesetzgeber | 121 | ||
| cc) Mitbestimmungsorgane und Drittbezug | 122 | ||
| (1) Verlagerung der Entscheidungsfindung | 122 | ||
| (2) Schuldrechtliche Einflussnahme | 124 | ||
| dd) Fazit | 125 | ||
| e) Zwischenergebnis | 125 | ||
| 3. Arbeitgeberstellung des Dritten für das Tarifrecht | 125 | ||
| a) Kollektivarbeitsrechtliche Bedeutung des US-amerikanischen joint employer | 125 | ||
| b) Definition des joint employer im kollektiven Arbeitsrecht | 126 | ||
| aa) Entwicklung vor 2015 | 126 | ||
| bb) Grundsatzentscheidung in der Rechtssache Browning Ferries Industries | 127 | ||
| cc) Final Rule aus dem Jahr 2020 | 128 | ||
| dd) Final Rule aus dem Jahr 2023 | 129 | ||
| c) Heranziehung des joint employer als Arbeitgeber im Sinne des National Labor Relations Act | 130 | ||
| d) Praktische Anwendung | 131 | ||
| e) Berücksichtigung des Drittbezugs in deutschen Tarifverträgen | 131 | ||
| f) Zwischenergebnis | 132 | ||
| 4. Zusammenfassung der Ergebnisse | 132 | ||
| IV. Internationales Zivilprozess- und Privatrecht | 132 | ||
| 1. Arbeitgeberstellung des Dritten im Sinne von Art. 21 Brüssel Ia-VO | 132 | ||
| a) Gedanklicher Ausgangspunkt | 132 | ||
| b) Verständnisse des Arbeitgeberbegriffs | 133 | ||
| aa) Ausgangsnorm: Art. 20 Abs. 1 Brüssel Ia-VO | 133 | ||
| bb) Arbeitsvertrag in der Drittbeziehung | 134 | ||
| (1) Europäisch-autonome Auslegung | 134 | ||
| (2) Qualifikationsrechtlicher Rechtsformzwang | 136 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 136 | ||
| cc) Anknüpfung an Arbeitsverhältnis | 137 | ||
| (1) Grundüberlegung | 137 | ||
| (2) Begriff des Arbeitsverhältnisses | 138 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 140 | ||
| dd) Vertrag zwischen Arbeitnehmer und Vertragsarbeitgeber | 140 | ||
| ee) Einordnung der Auffassungen | 141 | ||
| c) Zwischenergebnis | 142 | ||
| 2. Anwendbares Sachrecht, Art. 8 Abs. 1 Rom I-VO | 142 | ||
| a) Eröffnung des Anwendungsbereichs des Art. 8 Abs. 1 Rom I-VO | 142 | ||
| aa) Problemaufriss | 142 | ||
| bb) Einordnung von Sachverhalten arbeitsrechtlichen Drittbezugs | 143 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 144 | ||
| b) Bestimmung des maßgeblichen Rechts | 144 | ||
| aa) Grundregel des Art. 8 Rom I-VO | 144 | ||
| bb) Problemfelder in Sachverhalten arbeitsrechtlichen Drittbezugs | 145 | ||
| c) Fazit | 147 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 147 | ||
| V. Zusammenfassung und Einordnung | 147 | ||
| D. Nichtarbeitgeberlösungen | 148 | ||
| I. Systematisierung der Nichtarbeitgeberlösungen | 148 | ||
| II. Berücksichtigung des Drittbezugs im Verhältnis Arbeitnehmer – Dritter | 148 | ||
| 1. Rechtsgeschäftliche Zusagen des Dritten | 148 | ||
| 2. Leiharbeitsvertrag als echter Vertrag zugunsten des Entleihers | 149 | ||
| 3. Arbeitnehmerüberlassungsvertrag als Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten des Arbeitnehmers | 150 | ||
| 4. Gesetzliches Schuldverhältnis | 150 | ||
| 5. Ausdrückliche gesetzliche Regelungen | 151 | ||
| a) Arbeitsschutz | 151 | ||
| b) Auskunftsansprüche und Informationspflichten | 152 | ||
| c) Haftung aus § 14 S. 1 AEntG und § 13 MiLoG | 152 | ||
| d) Haftung für Entgeltanspruch | 153 | ||
| e) Einordnung der gesetzlichen Vorschriften | 153 | ||
| 6. Analoge Anwendung arbeitsrechtlicher Vorschriften | 154 | ||
| a) Die sogenannte „Gesamtanalogie“ | 154 | ||
| b) Analoge Anwendung einzelner Vorschriften | 154 | ||
| 7. Deliktische Ansprüche gegen den Dritten | 155 | ||
| 8. Zwischenergebnis | 156 | ||
| III. Berücksichtigung des Drittbezugs im Vertragsarbeitsverhältnis | 156 | ||
| 1. Gesetzliche Regelungen im englischen Arbeitsrecht: associated employer | 156 | ||
| a) Der Begriff des associated employer | 156 | ||
| b) Rechtsfolgen | 157 | ||
| aa) Vergleichsgruppe bei Lohngleichheit | 157 | ||
| bb) Persönlicher Anwendungsbereich gesetzlicher Vorschriften | 157 | ||
| cc) Bezugspunkt im Kündigungsrecht | 158 | ||
| 2. Anwendungsfälle aus dem deutschen Recht | 159 | ||
| a) Grundsatz der Gleichstellung, § 8 Abs. 1 S. 1 AÜG | 159 | ||
| b) Berechnungs- und Bemessungsdurchgriff im Konzern | 159 | ||
| c) Anrechnung von Vorbeschäftigungszeiten als Leiharbeitnehmer | 160 | ||
| d) Anrechnung von Vorbeschäftigungszeiten im Konzern | 160 | ||
| e) „Durchschlagen“ von Kündigungsgründen | 161 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 161 | ||
| IV. Lösung außerhalb des Zivilrechts: Öffentlich-rechtliche Sanktionen | 162 | ||
| 1. Ausgangspunkt: Verbot von Gestaltungsformen | 162 | ||
| 2. Folgen von Verstößen | 163 | ||
| a) Zivilrecht | 163 | ||
| b) Ordnungswidrigkeitenrecht | 164 | ||
| V. Zwischenergebnis | 165 | ||
| E. Ergebnis, Einordnung und Fortgang der Arbeit | 165 | ||
| I. Ergebnis | 165 | ||
| II. Einordnung des Ergebnisses: Verständnisse des Arbeitgeberbegriffs | 166 | ||
| 1. Arbeitgeber als Vertragspartner des Arbeitnehmers | 166 | ||
| a) Ersetzung des Vertragsarbeitgebers durch den Dritten | 166 | ||
| b) Nebeneinander zweier Arbeitgeber | 169 | ||
| 2. Abweichende Verständnisse des Arbeitgeberbegriffs | 171 | ||
| a) Gegenständliche Begrenzung der Arbeitgeberstellung | 171 | ||
| b) Einseitigkeit der Arbeitgeberstellung | 172 | ||
| c) Neudefinitionen des Begriffsinhaltes | 173 | ||
| d) Arbeitgeberbegriff als rechtliche Grundlage der Arbeitgeberstellung | 174 | ||
| aa) Gedanklicher Ausgangspunkt | 174 | ||
| bb) Reichweite der Arbeitgeberstellung unklar | 175 | ||
| cc) Kern der Ansätze: Begründungsstruktur für Arbeitgeberstellung | 176 | ||
| 3. Fazit | 176 | ||
| III. Fortgang der Arbeit: Untersuchung des individualarbeitsrechtlichen Arbeitgeberbegriffs | 177 | ||
| Kapitel 3: Der Arbeitgeberbegriff des Individualarbeitsrechts | 178 | ||
| A. Einführung | 178 | ||
| B. Arbeitgeber als andere Partei des Arbeitsvertrages | 178 | ||
| I. Historischer Ursprung des Arbeitgeberbegriffs | 178 | ||
| II. Inhalt des Arbeitgeberbegriffs | 180 | ||
| 1. Entwicklung | 180 | ||
| 2. Heutiges Verständnis | 182 | ||
| III. Ergebnis | 183 | ||
| C. Ausübung von Arbeitgeberfunktionen als Grundlage der Arbeitgeberstellung | 184 | ||
| I. Problemaufriss | 184 | ||
| II. Materiellrechtliches Verständnis des Arbeitgeberbegriffs | 184 | ||
| 1. Argumentationsstruktur | 184 | ||
| 2. Zweck eines materiellrechtlichen Arbeitgeberbegriffs | 185 | ||
| 3. Dogmatische Konstruktion | 186 | ||
| a) Arbeitsrecht als öffentlich-rechtliches Schutzrecht | 186 | ||
| b) Pflichten auf der Grundlage eines sozialen Schutzprinzips | 187 | ||
| c) Zwischenergebnis | 187 | ||
| III. Friktionen mit zivil- und verfassungsrechtlichen Grundsätzen | 188 | ||
| 1. Einführung | 188 | ||
| 2. Materieller Arbeitgeberbegriff und Vertragsfreiheit | 188 | ||
| a) Zivilrechtes Willensprinzip | 188 | ||
| b) Gewerbefreiheit | 191 | ||
| aa) Grundüberlegung | 191 | ||
| bb) Sklavenarbeit, Zwangsarbeit und Knechtschaft | 191 | ||
| cc) Privatautonom begründeter Arbeitsvertrag | 192 | ||
| dd) Zwischenergebnis | 195 | ||
| c) Verfassungsrecht | 195 | ||
| aa) Vertragsfreiheit und Berufsfreiheit, Art. 12 Abs. 1 GG | 195 | ||
| bb) Vertrags- und Berufsfreiheit des Arbeitnehmers | 197 | ||
| (1) Eingriff | 197 | ||
| (2) Rechtfertigung | 197 | ||
| cc) Vertrags- und Berufsfreiheit des Dritten | 201 | ||
| (1) Eingriff | 201 | ||
| (2) Rechtfertigungsmaßstab | 202 | ||
| (3) Verbesserung des arbeitsrechtlichen Schutzniveaus | 205 | ||
| (4) Verfassungsrechtliches Untermaßverbot | 205 | ||
| (a) Schutzfunktion von Art. 12 Abs. 1 GG und Sozialstaatsprinzip | 205 | ||
| (b) Untermaßverbot und Sachverhalte arbeitsrechtlichen Drittbezugs | 207 | ||
| (aa) Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers | 207 | ||
| (bb) Rechtfertigung für verfassungsrechtlich determinierte Fragen | 208 | ||
| (cc) Erforderlichkeit der Inanspruchnahme des Dritten | 208 | ||
| (5) Zwischenergebnis | 209 | ||
| d) Fazit | 209 | ||
| 3. Widerspruch zu gesetzgeberischen Konzeptionen | 209 | ||
| a) Arbeitnehmerüberlassungsgesetz | 209 | ||
| b) Rechtliche Selbstständigkeit der Konzerngesellschaften | 210 | ||
| 4. Zivilrechtsdogmatik: Kein eigenständiger Arbeitgeberbegriff | 211 | ||
| D. Ergebnis | 211 | ||
| Zusammenfassung der Ergebnisse | 213 | ||
| I. Unterschiedliche Verständnisse des Arbeitgeberbegriffs | 213 | ||
| II. Neudefinition des Arbeitgeberbegriffs | 213 | ||
| III. Vereinbarkeit der Neudefinitionen mit der Rechtsordnung | 214 | ||
| Literaturverzeichnis | 216 | ||
| Stichwortverzeichnis | 274 |
