Grenzen und Reichweite des Widerrufsanspruchs nach § 1 UKlaG
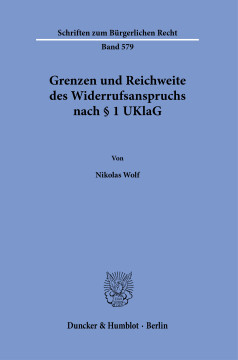
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Grenzen und Reichweite des Widerrufsanspruchs nach § 1 UKlaG
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 579
(2024)
Additional Information
Book Details
Pricing
About The Author
Nikolas Wolf studierte Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Steuerrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München und absolvierte anschließend das Referendariat im GPA Nord. Während seiner Promotion und dem anschließenden LL.M.-Studiums an der London School of Economics arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter für eine deutsche Rechtsanwaltskanzlei in Hamburg und London im Steuer- sowie im Kartellrecht. 2023 wurde er an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel promoviert. Seit 2024 ist er als Rechtsanwalt in der Praxisgruppe Steuerrecht einer internationalen Rechtsanwaltskanzlei tätig.Abstract
Einen Widerruf von Meinungen kennt nur der Ketzerprozess. Wie ist es im Hinblick auf den Widerruf von Empfehlungen? Der Anspruch auf Widerruf von Empfehlungen unwirksamer Geschäftsbedingungen nach § 1 UKlaG - als solcher ein Unikum in der deutschen Zivilrechtsordnung - bewegt sich im Spannungsverhältnis von Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung sowie von Kollektiv- und Individualrechtsschutz. Hieraus ergeben sich komplexe rechtsdogmatische und praktische Fragen. Das Werk versucht, ausgehend von den Grundlagen des Widerrufs und des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen diese Fragen zu klären und dabei den Widerrufsanspruch materiellrechtlich und zivilprozessual unter besonderer Berücksichtigung dessen grundrechtlicher Brisanz aufzuarbeiten. Neben der Klärung der grundrechtlichen Vereinbarkeit des Anspruchs bilden seine dogmatische Einordnung sowie die Betrachtung seiner tatbestandlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen die Schwerpunkte der Arbeit.»Limits and Scope of the Retraction Claim under Section 1 of the German Injunctions Act«: The revocation of opinions is only known in heresy trials. What about the revocation of recommendations? The claim to revoke recommendations of invalid terms and conditions under Section 1 Injunction Act is caught between the conflicting priorities of factual assertion and expression of opinion as well as collective and individual legal protection. Against this background, the work deals with the revocation claim in terms of substantive law and civil procedure, considering fundamental rights.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 17 | ||
| A. Einleitung | 21 | ||
| I. Gegenstand und Ziel dieser Untersuchung | 21 | ||
| II. Gliederung der Untersuchung | 22 | ||
| B. Einführung zum Widerrufsanspruch im Allgemeinen und zum Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen | 23 | ||
| I. Grundlagen des Widerrufsanspruchs | 23 | ||
| 1. Historische Entwicklung | 23 | ||
| a) Frühzeitliche Entwicklung des Widerrufsanspruchs | 24 | ||
| b) Rechtsprechung des Reichsgerichts | 25 | ||
| aa) Die Anerkennung eines Widerrufsanspruchs | 25 | ||
| bb) Merkmal der fortwirkenden Beeinträchtigung als Schutz des Anspruchsgegners | 26 | ||
| cc) Dogmatische Einordnung als Schadensersatz | 27 | ||
| dd) Dogmatische Einordnung als quasi-negatorischer Beseitigungsanspruch | 28 | ||
| c) Zusammenfassung/Fazit | 29 | ||
| 2. Begriff, Inhalt und Rechtsnatur der Widerrufserklärung | 29 | ||
| 3. Rechtsnatur des Widerrufsanspruchs | 30 | ||
| 4. Zielrichtung des Widerrufsanspruchs | 30 | ||
| 5. Rechtsdogmatische Wurzeln des Widerrufsanspruchs | 31 | ||
| a) Beseitigungsrechtliche Grundlage | 31 | ||
| b) Voraussetzungen | 32 | ||
| c) Rechtsfolgen | 32 | ||
| d) Abgrenzung zu anderen Anspruchsarten | 33 | ||
| aa) Abgrenzung zum Unterlassungsanspruch | 33 | ||
| bb) Abgrenzung zum Schadensersatzanspruch | 34 | ||
| 6. § 1004 BGB als Grundlage des Widerrufsanspruchs in der deutschen Rechtsordnung | 35 | ||
| a) Voraussetzungen | 35 | ||
| aa) Tatsachenbehauptungen | 35 | ||
| (1) Abgrenzung Werturteilen von Tatsachenbehauptungen | 36 | ||
| (2) Vorliegen eines Werturteils als Ausnahmefall | 37 | ||
| bb) Unwahr | 37 | ||
| cc) Behauptung | 38 | ||
| dd) Verletzungstatbestand | 38 | ||
| ee) Fortdauernde Beeinträchtigung | 38 | ||
| ff) Rechtswidrigkeit der Beeinträchtigung | 38 | ||
| gg) Passivlegitimation | 39 | ||
| hh) Aktivlegitimation | 40 | ||
| b) Beweislast | 40 | ||
| c) Rechtsfolgen | 41 | ||
| aa) Inhalt, Form und Umfang des Widerrufs | 41 | ||
| bb) Verhältnismäßigkeit | 42 | ||
| (1) Geeignetheit | 42 | ||
| (2) Erforderlichkeit | 42 | ||
| (3) Zumutbarkeit | 43 | ||
| d) Zwangsvollstreckung | 43 | ||
| e) Einstweiliges Verfügungsverfahren | 45 | ||
| 7. Zusammenfassung/Fazit | 46 | ||
| II. Grundlagen der Allgemeine Geschäftsbedingungen | 47 | ||
| 1. Bedeutung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Rechtsverkehr | 47 | ||
| 2. Der Begriff der Allgemeinen Geschäftsbedingung | 47 | ||
| 3. Geschichte der Allgemeinen Geschäftsbedingung | 48 | ||
| 4. Rechtsnatur | 49 | ||
| 5. Funktion | 50 | ||
| a) Rationalisierung und Beschleunigung des Rechtsverkehrs | 50 | ||
| b) Rechtssicherheit | 51 | ||
| c) Erhalt und Verstärkung wirtschaftlicher Machtstellungen | 51 | ||
| 6. Missbrauchsgefahr | 52 | ||
| 7. Rechtfertigungsbedürfnis einer Inhaltskontrolle und Ausfall der Marktwirkung | 52 | ||
| 8. Rechtfertigung einer Inhaltskontrolle | 53 | ||
| 9. Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen | 54 | ||
| a) Die Entwicklung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der deutschen Zivilrechtsordnung | 54 | ||
| aa) Der richterrechtliche Ursprung des AGB-Rechts | 54 | ||
| bb) Das AGB-Gesetz von 1976 | 57 | ||
| cc) Gesetzgebung seit Inkrafttreten des AGBG | 59 | ||
| (1) Richtlinie 93/13/EWG | 59 | ||
| (2) Schuldrechtsreform | 59 | ||
| dd) Struktur des Unterlassungsklagengesetzes | 60 | ||
| ee) Änderungen des AGB-Rechts nach Erlass des UKlaG | 61 | ||
| b) Das heutige AGB-Recht | 62 | ||
| 10. Zusammenfassung/Fazit | 62 | ||
| C. Der Widerrufsanspruch nach § 1 UKlaG | 64 | ||
| I. Allgemeines | 64 | ||
| 1. Entwicklung und Grundlagen des Widerrufsanspruchs | 64 | ||
| a) Widerrufsanspruch im AGBG | 64 | ||
| b) Unionsrechtliche Vorgaben | 65 | ||
| 2. Abstraktionsniveau der abstrakten Klauselkontrolle | 66 | ||
| 3. Hintergrund der Abstraktion und Zielsetzung des Widerrufsanspruchs im Unterlassungsklagegesetz | 66 | ||
| a) Hintergrund der Abstraktion des Widerrufsanspruchs | 66 | ||
| aa) Das Problem der individuellen Rechtsbewährung im deutschen Zivilrecht | 67 | ||
| bb) Das Problem der subjektiven Reichweite von Urteilen | 68 | ||
| cc) Das Problem von Klauselempfehlungen | 68 | ||
| (1) Verbreitung von Konditionenempfehlungen | 69 | ||
| (2) Auswirkung von Konditionenempfehlungen | 69 | ||
| dd) Zusammenfassung/Fazit | 70 | ||
| b) Die allgemeine Funktion von § 1 UKlaG | 70 | ||
| c) Die besondere Funktion des Widerrufsanspruchs nach § 1 UKlaG | 72 | ||
| d) Zusammenfassung/Fazit | 73 | ||
| 4. Widerrufsanspruch als kollektives Rechtsschutzinstrument | 74 | ||
| a) Kollektive Rechtsschutzinstrumente in der deutschen Rechtsordnung | 74 | ||
| b) Formen kollektiver Rechtsschutzinstrumente in der deutschen Zivilrechtsordnung | 75 | ||
| aa) Verbandsklagen | 75 | ||
| bb) Gruppenklagen | 75 | ||
| cc) Musterklagen | 76 | ||
| dd) Amtsklagen | 76 | ||
| c) Einordnung des Widerrufsanspruchs nach § 1 UKlaG | 76 | ||
| 5. Rechtsnatur des Widerrufsanspruchs | 77 | ||
| 6. Einordnung des Widerrufsanspruchs als Abwehr- oder Beseitigungsanspruch | 77 | ||
| a) Vorbeugender Abwehranspruch | 77 | ||
| b) Beseitigungsanspruch | 78 | ||
| c) Stellungnahme | 78 | ||
| d) Zusammenfassung/Fazit | 79 | ||
| 7. Klauselkontrollen jenseits des Widerrufsanspruchs in § 1 UKlaG | 79 | ||
| a) Verhältnis zum Unterlassungsanspruch in § 1 UKlaG | 79 | ||
| b) Verhältnis zum Individualprozess | 80 | ||
| c) Verhältnis zu § 8 UWG | 80 | ||
| d) Verhältnis zu § 2 UKlaG | 81 | ||
| 8. Zusammenfassung/Fazit | 81 | ||
| II. Materiell-rechtliche Voraussetzungen | 81 | ||
| 1. Anwendbarkeit | 81 | ||
| a) Funktion des § 15 UKlaG | 82 | ||
| b) Umfang der Bereichsausnahme nach § 15 UKlaG | 82 | ||
| c) Zusammenfassung/Fazit | 83 | ||
| 2. Bestimmungen in Allgemeine Geschäftsbedingungen | 83 | ||
| a) Allgemeine Geschäftsbedingungen i.S.d. § 1 UKlaG | 83 | ||
| b) Bestimmungen i.S.d. § 1 UKlaG | 84 | ||
| c) Einmal-Klauseln | 85 | ||
| d) Ergänzungsbedürftige Klauseln | 85 | ||
| e) Umgehung durch rechtliche Gestaltungen | 86 | ||
| f) Hoheitlich vorgegebene Vertragsbedingungen | 87 | ||
| 3. Unwirksamkeit | 87 | ||
| a) Abstraktheit der Klauselkontrolle | 87 | ||
| b) Prüfungsgegenstand | 88 | ||
| aa) Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber Unternehmern | 89 | ||
| bb) Behördliche genehmigte Allgemeine Geschäftsbedingungen | 89 | ||
| cc) Bestimmungen i.S.d. § 307 Abs. 3 BGB | 89 | ||
| dd) Zusammenfassung/Fazit | 90 | ||
| c) Inhaltsbestimmung | 90 | ||
| d) Prüfungsmaßstab | 91 | ||
| aa) Verstöße gegen die §§ 307 bis 309 BGB | 92 | ||
| bb) Verstöße gegen allgemeines zwingendes Recht | 93 | ||
| (1) Zwingendes Recht mit vergleichbarer Schutzrichtung | 94 | ||
| (2) Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB | 94 | ||
| (a) Abstrakte Sittenwidrigkeit | 95 | ||
| (b) Verhältnis zu § 307 BGB | 95 | ||
| (c) Zusammenfassung/Fazit | 96 | ||
| (3) Zusammenfassung/Fazit | 96 | ||
| cc) Verstöße gegen Einbeziehungsvorschriften | 96 | ||
| (1) Unselbständige Verstöße gegen Einbeziehungsvorschriften | 97 | ||
| (2) Selbständige Verstöße gegen Einbeziehungsvorschriften | 97 | ||
| (a) Ableitungen aus dem Urteil | 98 | ||
| (b) Verstöße gegen § 305c Abs. 1 BGB | 99 | ||
| (3) Zusammenfassung/Fazit | 100 | ||
| dd) Verstöße gegen ausländisches Recht | 100 | ||
| ee) Zusammenfassung/Fazit | 100 | ||
| e) Zusammenfassung/Fazit | 101 | ||
| 4. Empfehlung für den rechtsgeschäftlichen Verkehr | 101 | ||
| a) Leitbild der Empfehlung für den rechtsgeschäftlichen Verkehr | 101 | ||
| b) Empfehlung i.S.d. § 1 UKlaG | 101 | ||
| aa) Empfehlung als kommunikativer Akt der Willensbeeinflussung | 102 | ||
| bb) Entschließungsfreiheit | 104 | ||
| cc) Verwendungsinteresse des Empfehlenden | 104 | ||
| dd) Rechtserheblichkeit der Empfehlung | 104 | ||
| ee) Abgrenzung zur Verwendung und Hilfstätigkeiten | 105 | ||
| (1) Verwendungen | 105 | ||
| (2) Hilfstätigkeiten | 105 | ||
| (3) Zusammenfassung/Fazit | 108 | ||
| ff) Zusammenfassung/Fazit | 108 | ||
| c) Für den rechtsgeschäftlichen Verkehr | 108 | ||
| aa) Funktion des Tatbestandsmerkmals | 108 | ||
| bb) Dogmatische Einordnung | 109 | ||
| (1) Theorie des allgemein kommerziellen Interesses | 109 | ||
| (2) Theorie der Bereichsausnahme | 110 | ||
| (3) Theorie über die Bestimmung des Adressatenkreises | 110 | ||
| (4) Irrelevanztheorie | 111 | ||
| (5) Zusammenfassung/Fazit | 111 | ||
| cc) Inhalt | 111 | ||
| (1) Begriffsbestimmung | 112 | ||
| (2) Klassifikation des Verkehrs | 113 | ||
| (3) Klassifikation als rechtsgeschäftlich | 114 | ||
| (4) Zwischenergebnis/Fazit | 114 | ||
| 5. Fortwirkende Beeinträchtigung | 115 | ||
| 6. Anspruchsgegner | 115 | ||
| III. Anspruchsberechtigung | 117 | ||
| 1. Rechtsnatur der Anspruchsberechtigung | 119 | ||
| a) Praktische Relevanz | 119 | ||
| b) Keine unionsrechtlichen Vorgaben | 121 | ||
| c) Prozessuale Theorie | 122 | ||
| d) Materiell-rechtliche Theorie | 123 | ||
| e) Lehre über die Doppelnatur | 125 | ||
| f) Stellungnahme | 126 | ||
| aa) Zugrundeliegende gesetzgeberischer Intention | 126 | ||
| bb) Funktionen des § 3 Abs. 1 Satz 1 UKlaG | 127 | ||
| cc) Ungenügen einer rein materiellen Vorschrift | 128 | ||
| dd) Inkompatibilität als Prozessführungsbefugnis | 129 | ||
| (1) Funktion der Prozessführungsbefugnis | 129 | ||
| (2) Vereinbarkeit von gesetzgeberischer Intention und Funktion der Prozessführungsbefugnis | 130 | ||
| ee) Einordnung als Kriterium des Rechtsschutzbedürfnisses | 131 | ||
| g) Zusammenfassung/Fazit | 132 | ||
| 2. Anspruchsberechtigte Stellen | 133 | ||
| a) Qualifizierte Einrichtungen | 133 | ||
| b) Qualifizierte Wirtschaftsverbände | 134 | ||
| c) Sonstige Anspruchsinhaber | 135 | ||
| aa) Öffentlich-rechtliche Berufskammern | 135 | ||
| bb) Nach der Handwerksordnung errichtete Organisationen | 136 | ||
| cc) Gewerkschaften | 136 | ||
| 3. Zusammenfassung/Fazit | 139 | ||
| IV. Darlegungs- und Beweislast | 139 | ||
| V. Die Widerrufserklärung | 139 | ||
| 1. Die Veröffentlichung des Urteils als Widerrufserklärung? | 140 | ||
| 2. Inhalt der Widerrufserklärung | 142 | ||
| 3. Art und Weise der Widerrufserklärung | 142 | ||
| 4. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als immanente Grenze des Widerrufsanspruchs | 143 | ||
| a) Geeignetheit | 144 | ||
| b) Erforderlichkeit | 144 | ||
| c) Zumutbarkeit | 145 | ||
| d) Zusammenfassung/Fazit | 147 | ||
| 5. Weitere Ansprüche neben dem Widerrufsanspruch | 147 | ||
| a) Unterlassungsanspruch | 147 | ||
| b) Allgemeiner Folgenbeseitigungsanspruch | 149 | ||
| c) Schadensersatzanspruch | 151 | ||
| d) Veröffentlichung Anspruch gemäß § 7 UKlaG | 152 | ||
| VI. Übertragbarkeit des Widerrufsanspruchs | 153 | ||
| VII. Materiell-rechtliche Einwendungen | 154 | ||
| 1. Verjährung | 154 | ||
| 2. Verwirkung | 156 | ||
| 3. Missbrauchseinwand nach § 2b Satz 1 UKlaG | 156 | ||
| 4. Zusammenfassung/Fazit | 159 | ||
| D. Verfahrensrechtliche Aspekte des Widerrufsanspruchs | 160 | ||
| I. Prozessmaxime | 160 | ||
| 1. Dispositionsmaxime | 161 | ||
| a) Allgemeines | 161 | ||
| b) Disponibilität der Widerrufsklage | 161 | ||
| 2. Beibringungsgrundsatz | 163 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 165 | ||
| II. Streitgegenstandsbezogene Verfahrensaspekte | 165 | ||
| 1. Der Streitgegenstand der Widerrufsklage | 165 | ||
| a) Der Streitgegenstand in der Zivilprozessordnung | 165 | ||
| b) Die Konkretisierung des Streitgegenstandes in der Widerrufsklage | 167 | ||
| 2. Urteilsart | 168 | ||
| 3. Die Rechtshängigkeitsaspekte der Widerrufsklage | 169 | ||
| a) Voraussetzungen der Rechtshängigkeit | 169 | ||
| aa) Besondere Anforderungen an die Bestimmtheit der Widerrufsklage gemäß § 8 Abs. 1 UKlaG | 169 | ||
| bb) Erfordernis einer außergerichtlichen Abmahnung gemäß § 5 UKlaG i.V.m. § 13 Abs. 1 UWG? | 170 | ||
| b) Rechtsfolgen der Rechtshängigkeit | 170 | ||
| aa) Materiell-rechtliche Wirkungen | 170 | ||
| bb) Prozessuale Wirkungen | 171 | ||
| (1) Einrede der Rechtshängigkeit (§ 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO) | 171 | ||
| (a) Mehrfachklagen | 171 | ||
| (b) Negative Feststellungsklage | 172 | ||
| (c) Auswirkung der Rechtshängigkeit auf Individualklageverfahren | 173 | ||
| (2) Perpetuatio fori, § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO | 174 | ||
| (3) Klageänderung in der Widerrufsklage | 174 | ||
| (4) Drittbeteiligung | 174 | ||
| (a) Möglichkeiten der Nebenintervention und Streitverkündung in der Widerrufsklage | 174 | ||
| (b) Anhörung nach § 8 Abs. 2 UKlaG | 176 | ||
| c) Ende der Rechtshängigkeit – Anwendbarkeit prozessbeendigender Institute auf die Widerrufsklage | 177 | ||
| aa) Klagerücknahme | 177 | ||
| bb) Übereinstimmende Erledigungserklärung | 177 | ||
| cc) Prozessvergleich | 178 | ||
| 4. Rechtskraft des Widerrufsurteils | 180 | ||
| a) Materielle Rechtskraft eines Widerrufsurteils | 180 | ||
| aa) Anerkenntnis- und Verzichtsurteile | 181 | ||
| bb) Bindung an Antrag | 182 | ||
| b) Grenzen der Rechtskrafterstreckung | 183 | ||
| aa) Subjektive Grenzen der Rechtskrafterstreckung | 183 | ||
| bb) Objektive Grenzen der Rechtskrafterstreckung | 184 | ||
| c) Zusammenfassung | 184 | ||
| 5. Vollstreckung des Widerrufsurteils | 185 | ||
| 6. Vorläufiger Rechtsschutz | 186 | ||
| 7. Zusammenfassung | 186 | ||
| III. Parteibezogene Verfahrensaspekte | 187 | ||
| IV. Gerichtsbezogene Verfahrensaspekte | 187 | ||
| V. Rechtsschutzbedürfnis | 189 | ||
| VI. Zusammenfassung/Fazit | 189 | ||
| E. Grundrechte | 190 | ||
| I. Die Meinungsfreiheit, Art. 5 Abs. 1 GG | 190 | ||
| 1. Der Schutzbereich der Meinungsfreiheit | 191 | ||
| 2. Rechtsbehauptungen und Rechtsansichten | 192 | ||
| 3. Der Widerrufsanspruch im Lichte der Meinungsfreiheit | 193 | ||
| 4. Konsequenzen aus der Einordnung einer Empfehlung als Meinungsäußerung | 194 | ||
| 5. Zusammenfassung/Fazit | 194 | ||
| II. Die Wissenschaftsfreiheit, Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 195 | ||
| III. Die Berufsfreiheit, Art. 12 Abs. 1 GG | 195 | ||
| IV. Die Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG | 196 | ||
| V. Der Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit, Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG | 197 | ||
| F. Ergebnisse | 200 | ||
| Literaturverzeichnis | 204 | ||
| Stichwortverzeichnis | 218 |
