Rechtszuweisung und Rechtsschutz bei der erbrechtlichen Auflage
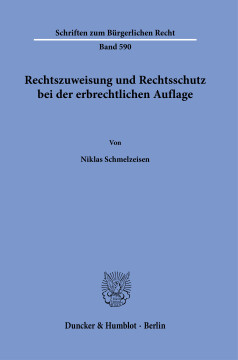
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Rechtszuweisung und Rechtsschutz bei der erbrechtlichen Auflage
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 590
(2025)
Additional Information
Book Details
About The Author
Niklas Schmelzeisen studierte Rechtswissenschaft in Heidelberg und Florenz. Nach Abschluss des ersten juristischen Staatsexamens absolvierte er das Referendariat am OLG Frankfurt a.M. Seitdem ist er als Rechtsanwalt in Frankfurt a.M. tätig.Abstract
Die erbrechtliche Auflage (§§ 1940, 2192 ff. BGB) schafft eine Pflicht des mit ihr Beschwerten, der keine Berechtigung einer lebenden Person gegenübersteht. Sie erscheint daher auf den ersten Blick als Fremdkörper in einem Privatrechtssystem, dessen Regelungsgegenstand die Zuweisung von Rechten ist. Die dogmatischen Grundlagen der erbrechtlichen Auflage sind bis heute nicht abschließend geklärt. Daraus resultiert eine Vielzahl an Problemen und Unsicherheiten bei der praktischen Anwendung dieser Rechtsfigur. Die Arbeit entwickelt unter Berücksichtigung der rechtsgeschichtlichen Grundlagen der Auflage eine Einordnung der erbrechtlichen Auflage in das Privatrechtssystem, um auf dieser Basis im Anschluss die Anwendungsprobleme systematisch kohärenten Lösungen zuzuführen. Die Auflage erweist sich dabei als ein erbrechtliches Gestaltungsinstrument, das trotz struktureller Schwächen über ein genuin eigenes Anwendungsgebiet verfügt.»The Testamentary Burden. Allocation of Rights and Legal Protection«: The testamentary burden (section 1940 of the German Civil Code) regularly confronts courts and legal experts with complex questions regarding its application. This work examines the dogmatic structure of the testamentary burden, taking into account its legal-historical foundations and the fundamental principles of German private law. On this basis, the work develops systematically coherent solutions to the as yet unresolved issues in the application of the testamentary burden.
