Die Hinweisgeberverantwortung des Wirtschaftsanwalts
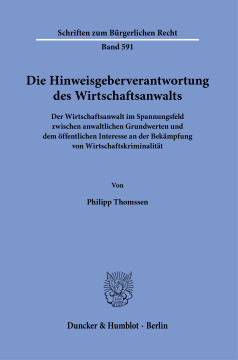
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Hinweisgeberverantwortung des Wirtschaftsanwalts
Der Wirtschaftsanwalt im Spannungsfeld zwischen anwaltlichen Grundwerten und dem öffentlichen Interesse an der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 591
(2025)
Additional Information
Book Details
About The Author
Philipp Thomssen ist Rechtsanwalt und Partner einer Wirtschaftskanzlei in Norddeutschland. Er berät Unternehmen und Investoren in den Bereichen M&A-Transaktionen, Umstrukturierungen sowie bei gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen. Nach seinem Studium in Hamburg und London war er promotionsbegleitend als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Wirtschaftskanzlei tätig. Anschließend absolvierte er das Referendariat in Hamburg, Mailand und San Diego. Nach dem zweiten Staatsexamen begann er seine anwaltliche Karriere bei einer US-amerikanischen Wirtschaftskanzlei in Hamburg, bevor er zu seiner jetzigen Kanzlei nach Lübeck wechselte.Abstract
Bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität spielt der Zugriff auf das Insiderwissen von Hinweisgebern eine immer wichtigere Rolle. Dabei geraten zunehmend auch wirtschaftsberatende Rechtsanwälte und andere vergleichbare Berufsträger als Informationsquelle in den Fokus. Die Arbeit untersucht berufs- und außerberufsrechtliche Pflichten der Anwaltschaft zur Verhinderung und Aufklärung von Wirtschaftsstraftaten und die daraus folgenden Konfliktlinien zwischen der Nutzung anwaltlichen Sonderwissens zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität einerseits sowie der anwaltlichen Verschwiegenheit und Unabhängigkeit andererseits. Dazu greift die Untersuchung die vor allem in den Vereinigten Staaten geführte Diskussion und dortige Regulierungsansätze zur Einbindung von Anwälten in die Corporate Governance auf und überträgt diese auf das deutsche Recht, wobei neueste Rechtsentwicklungen wie das Hinweisgeberschutzgesetz einbezogen werden.»Whistleblowing by Corporate Lawyers. The Corporate Lawyer Between Core Values of the Legal Profession and the Public Interest in the Fight Against White-Collar Crime«: Corporate lawyers are increasingly becoming potential sources of information in combating white-collar crime. This study explores the inherent conflicts between the disclosure of privileged information to address corporate misconduct and the fundamental principles of legal confidentiality and professional independence. Therefore, the study analyses the ongoing debates and regulatory approaches regarding the role of lawyers in corporate governance, with a particular focus on the United States.
