Schadensersatz bei Unternehmenskäufen
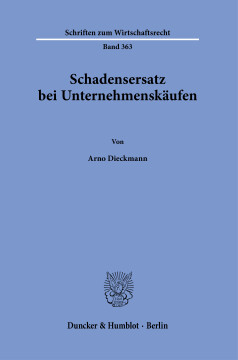
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Schadensersatz bei Unternehmenskäufen
Schriften zum Wirtschaftsrecht, Vol. 363
(2025)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Einleitung | 19 | ||
| § 1 Die Grundbegriffe des Unternehmenskaufs | 23 | ||
| A. Mergers & Acquisitions als Unternehmenskauf | 23 | ||
| I. Uneinheitliche Begriffsverwendung in den Wirtschaftswissenschaften | 23 | ||
| II. Fusionen und Übernahmen (M&A) als Unternehmenskäufe | 25 | ||
| B. „Unternehmen“ als Gegenstand des Kaufvertrags | 27 | ||
| I. Ambivalenter Begriff im Recht | 27 | ||
| II. Umfassender Unternehmensbegriff im Recht des Unternehmenskaufs | 28 | ||
| C. Die Formen des Unternehmenskaufs | 29 | ||
| I. Einzelübertragung aller Gegenstände (Asset Deal) | 29 | ||
| II. Teilunternehmenskauf vs. Inventarkauf | 30 | ||
| III. Der Kauf von Geschäftsanteilen (Share Deal) | 31 | ||
| 1. Rechtliche Übertragung der Geschäftsanteile | 31 | ||
| 2. Übernahme der Leitungsbefugnis (Abgrenzung zum Anteilskauf) | 33 | ||
| D. Zusammenfassung des Kapitels | 36 | ||
| § 2 Haftung aus Garantien, Gewährleistung und Aufklärungspflichten | 38 | ||
| A. Vertragliche Garantievereinbarungen im Unternehmenskaufvertrag | 38 | ||
| I. Haftung aus selbstständigen Garantien i.S.v. § 311 Abs. 1 BGB | 38 | ||
| II. Überblick über das vertragliche Haftungsregime (Garantiekatalog) | 41 | ||
| 1. Die allgemeine Bilanzgarantie | 41 | ||
| a) Ausgestaltung des Tatbestands | 42 | ||
| b) Tatbestandsverletzung: „weiche“ vs. „harte“ Bilanzgarantien | 46 | ||
| 2. Die Eigenkapitalgarantie | 51 | ||
| 3. Selbstständige Beschaffenheitsgarantien | 52 | ||
| 4. Sonstige selbstständige Garantien | 53 | ||
| B. Kaufgewährleistung beim Unternehmenskauf | 55 | ||
| I. Schadensersatzansprüche und Mängelgewährleistung | 56 | ||
| II. Der Mangelbegriff beim Unternehmen, §§ 453, 434 BGB | 57 | ||
| 1. Anwendungsbereich des § 434 BGB | 57 | ||
| 2. Sachmangel des Unternehmens (fehlerhafte Einzelgegenstände) | 59 | ||
| a) Gesamtbetrachtungslehre | 59 | ||
| b) Objektive Beschaffenheit des Unternehmens | 60 | ||
| c) Beispiel aus der Rechtsprechung | 62 | ||
| III. Finanzkennzahlen des Unternehmens als Sachmangel | 64 | ||
| 1. Bedeutung des Beschaffenheitsbegriffs | 64 | ||
| 2. Umsätze und Erträge vergangener Perioden | 65 | ||
| a) „Einfluss auf die Wertschätzung der Sache“ (ständige Rspr.) | 67 | ||
| b) Ertragsfähigkeit als Beschaffenheit | 69 | ||
| aa) Umsätze mehrerer Jahre (restriktive Linie der Rechtsprechung) | 69 | ||
| bb) Zusammenhang von Finanzkennzahlen und Ertragsfähigkeit (Vergangenheitsanalyse in der Unternehmensbewertung) | 70 | ||
| c) Kaufrechtliche Haftung wegen verminderter Ertragsfähigkeit | 72 | ||
| 3. Zukünftige Umsätze und Erträge | 74 | ||
| 4. Sonstige Bilanzangaben als Beschaffenheit des Unternehmens (kaufvertragliche Bilanzgarantie) | 76 | ||
| IV. Mängelgewährleistung bei Beteiligungen an Unternehmen | 78 | ||
| V. Rechtsmängel am Unternehmen | 79 | ||
| VI. Dispositivität des Kaufgewährleistungsrechts | 80 | ||
| 1. Allgemeine Geschäftsbedingungen | 80 | ||
| a) Genereller Ausschluss der Kaufgewährleistung | 80 | ||
| b) Sonstige Klauseln | 83 | ||
| 2. Individualvereinbarung | 85 | ||
| C. Die culpa in contrahendo beim Unternehmenskauf | 87 | ||
| I. Aufklärungspflichtverletzung | 88 | ||
| 1. Allgemeines | 88 | ||
| 2. Anforderungen an die Offenbarungspflichten (Digitale Datenräume) | 90 | ||
| 3. Haftungsausschluss wegen Kenntnis analog § 442 BGB | 91 | ||
| II. Culpa in contrahendo bei „potenziellen Beschaffenheitsvereinbarungen“ | 93 | ||
| 1. Haftungslücke durch umfassende Sperrwirkung | 94 | ||
| 2. Kontinuität der Rechtsprechung | 95 | ||
| a) Reichsgericht und BGH vor der Schuldrechtsreform | 95 | ||
| b) Neue Rechtsprechung des BGH | 96 | ||
| 3. Methodologische Begründung gewährleistungsrechtlicher Spezialität | 97 | ||
| a) Wille des Gesetzgebers | 98 | ||
| b) Wortlaut, Systematik, Telos | 99 | ||
| 4. Ergebnis | 101 | ||
| III. Anwendbarkeit der c.i.c. bei Arglist des Verkäufers | 102 | ||
| IV. Weitere Anwendungsfälle der culpa in contrahendo | 102 | ||
| V. Dispositivität der culpa in contrahendo | 103 | ||
| 1. Abdingbarkeit durch Allgemeine Geschäftsbedingungen | 103 | ||
| 2. Abdingbarkeit durch Individualvereinbarung | 105 | ||
| a) Ausdrücklich | 105 | ||
| b) Konkludente Abdingbarkeit (Sperrwirkung der Garantie) | 107 | ||
| D. Zusammenfassung des Kapitels | 107 | ||
| § 3 Grundsätze des Schadensersatzrechts nach §§ 249ff. BGB | 112 | ||
| A. Prinzipienlehre im Schadensersatzrecht | 113 | ||
| B. Schadensberechnung | 117 | ||
| I. Die Schadensberechnung „in a nutshell“ | 117 | ||
| II. Systembruch durch dualistischen Schadensbegriff | 118 | ||
| III. Das auszugleichende Interesse | 121 | ||
| 1. Zustandsvergleich, Interesse und ersatzfähiger Schaden | 121 | ||
| 2. Positives und negatives Interesse | 122 | ||
| C. Vorrang der Naturalrestitution | 123 | ||
| I. Systematik und Schutzgehalt | 123 | ||
| II. Prinzip der Totalreparation | 126 | ||
| 1. Totalreparation vorrangig durch Naturalrestitution | 127 | ||
| 2. Optimierung der Totalreparation durch Naturalrestitution | 128 | ||
| III. Integritätsinteresse als Legitimation der Naturalherstellung | 129 | ||
| 1. Integritätszuschlag im Verhältnis Restitution zu Kompensation | 129 | ||
| 2. Integritätszuschlag im Verhältnis Restitution zu Restitution | 130 | ||
| a) Vorrang der Instandsetzung | 130 | ||
| b) Ausnahmsweise Vorrang der Ersatzbeschaffung | 131 | ||
| IV. Grenzen der Naturalrestitution | 132 | ||
| 1. Unmöglichkeit, Unverhältnismäßigkeit und Ungenügen, § 251 BGB | 132 | ||
| 2. Bereicherungsverbot | 134 | ||
| a) Materieller Regelungsgehalt | 134 | ||
| b) Vorteilsausgleichung | 135 | ||
| 3. Wirtschaftlichkeitsgebot | 137 | ||
| D. Arten der Naturalrestitution | 138 | ||
| I. In Natur, § 249 Abs. 1 BGB | 138 | ||
| 1. Grundsatz der Wiederherstellung | 138 | ||
| 2. Restitutionsvermögensschäden (Differenzhypothese) | 139 | ||
| 3. Tatbestand des entgangenen Gewinns, § 252 BGB | 140 | ||
| II. Kosten der Wiederherstellung, §§ 249 Abs. 2 S. 1, 250 BGB | 141 | ||
| 1. Anwendungsbereich des § 249 Abs. 2 S. 1 BGB (Ersetzungsbefugnis) | 141 | ||
| 2. Fristsetzungserfordernis, § 250 BGB | 142 | ||
| a) Regelungsgehalt | 142 | ||
| b) Anwendungsbereich beim Unternehmenskauf (Garantievereinbarungen) | 144 | ||
| aa) Bestands- und Funktionssicherung von Vermögensgütern | 144 | ||
| bb) Sonstige Garantien (Bilanzgarantien) | 146 | ||
| 3. Matrix der erforderlichen Wiederherstellungskosten | 146 | ||
| a) Fiktive Schadensberechnung | 148 | ||
| aa) Rechtsprinzip der Dispositionsfreiheit | 148 | ||
| bb) Wiederherstellungskosten i.e.S. (Reparaturkosten) | 151 | ||
| (1) Privilegierende Art der Schadensberechnung | 151 | ||
| (2) Keine Wiederherstellungskosten bei Verwertung der Sache | 152 | ||
| cc) Ersatzbeschaffung | 154 | ||
| (1) Dualismus der Naturalrestitution | 154 | ||
| (2) Wiederbeschaffungsaufwand als normativer Schaden | 157 | ||
| (3) Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit | 158 | ||
| b) Konkrete Berechnung der Wiederherstellungskosten | 160 | ||
| E. Wertkompensation, § 251 BGB | 162 | ||
| I. Anwendungsbereich der Differenzhypothese | 163 | ||
| II. Normativer Schaden im weiteren Sinn | 165 | ||
| III. Schlussfolgerungen | 167 | ||
| F. Zusammenfassung des Kapitels | 168 | ||
| § 4 Schadensersatz aus Garantien, Gewährleistung und Aufklärungspflichten | 174 | ||
| A. Garantieverletzungen | 174 | ||
| I. Anwendbarkeit der §§ 249ff. BGB | 174 | ||
| 1. Mit §§ 249ff. BGB korrespondierende Rechtsfolgenklauseln | 174 | ||
| 2. Grenzen der Wirksamkeit abweichender Rechtsfolgenklauseln | 175 | ||
| a) Überblick zur Vertragspraxis | 175 | ||
| b) AGB-Inhaltskontrolle | 177 | ||
| c) Individualvereinbarungen | 180 | ||
| II. Der Schaden am Unternehmenswert am Beispiel der Bilanzgarantie | 183 | ||
| 1. Das schadensrechtliche „Interesse“ bei der Bilanzgarantie | 183 | ||
| a) Nachträgliche Bilanzkorrektur | 183 | ||
| b) Bestand und Beschaffenheit der Vermögensgüter | 184 | ||
| c) Wert des Unternehmens (positives Interesse) | 185 | ||
| aa) Abgrenzung zum negativen Interesse | 185 | ||
| bb) Saldierung gegensätzlicher Werteffekte von Bilanzierungsfehlern | 187 | ||
| 2. (Prozess-)Rechtlicher Rahmen des Unternehmenswertschadens | 188 | ||
| a) Sachverständigengutachten – Bewertungsspielräume | 188 | ||
| b) Schadensersatz als Bewertungszweck | 189 | ||
| 3. Allgemeine schadensrechtliche Implikationen | 191 | ||
| a) Wertkategorien: subjektbezogene Schadensbetrachtung | 192 | ||
| aa) Maßgeblichkeit des subjektiven Entscheidungswerts | 192 | ||
| bb) Beispiel | 194 | ||
| b) Schadensrechtlicher Bewertungsstichtag | 195 | ||
| c) Bewertungsrelevante Zäsur der Schadensersatzerfüllung | 197 | ||
| d) Entgehende Gewinne der Zukunft und entgangene Gewinne der Vergangenheit (§ 252 S. 2 BGB) | 198 | ||
| e) Berücksichtigung von Synergieeffekten | 199 | ||
| 4. Bewertungsverfahren | 201 | ||
| a) Grundannahmen | 201 | ||
| b) Bewertungsmethoden nach IDW S. 1 (2008) | 202 | ||
| aa) Ertragswertverfahren | 203 | ||
| bb) Discounted Cashflow-Verfahren | 204 | ||
| (1) Grundlagen | 204 | ||
| (2) Beispiel: Unternehmenswertberechnung nach Bruttomethode (WACC-Ansatz) | 206 | ||
| c) Schadensrechtsrechtliche Vorgaben zu den Bewertungsmethoden | 208 | ||
| aa) Auswirkungen subjektbezogener Schadensberechnung | 209 | ||
| bb) Schadensberechnung analog zur Kaufpreisbestimmung | 210 | ||
| cc) Schadensberechnung durch Multiplikatorenverfahren | 210 | ||
| dd) Richtigkeit der Bewertungsmaßstäbe | 211 | ||
| 5. Methodenkonforme Schadensberechnung | 212 | ||
| a) „Bilanzauffüllung“ | 212 | ||
| aa) Die Methode | 212 | ||
| bb) Die Kritik | 213 | ||
| cc) Schlussfolgerungen | 214 | ||
| b) Nicht betriebsnotwendiges Vermögen | 216 | ||
| c) Betriebsnotwendiges Vermögen | 218 | ||
| aa) Trias der Schadensberechnung | 218 | ||
| bb) Einzelne Bilanzpositionen | 221 | ||
| (1) Bargeld, Bankguthaben, Forderungen | 221 | ||
| (2) Finanzanlagen, Wertpapiere | 223 | ||
| (3) Sachanlagen, Vorräte | 223 | ||
| (4) Immaterielle Vermögensgegenstände | 224 | ||
| cc) Passiva | 226 | ||
| (1) Verbindlichkeiten | 226 | ||
| (2) Rückstellungen | 229 | ||
| III. Sonstige bedeutende Verkäufergarantien | 231 | ||
| 1. Eigenkapitalgarantie (privatautonome Bilanzauffüllung) | 231 | ||
| 2. Selbstständige Beschaffenheitsgarantien | 232 | ||
| 3. Gewerbliche Schutzrechte | 233 | ||
| 4. Informationstechnologie (Datenverlust) | 234 | ||
| a) Cyberkriminalität: „Datenklau“ | 234 | ||
| b) Datenvernichtung | 235 | ||
| IV. Konkurrenzen | 236 | ||
| 1. Haftungsbegründung | 236 | ||
| 2. Verbot der Doppelkompensation (Bereicherungsverbot) | 236 | ||
| a) Kaufpreisanpassung vs. Bilanzgarantie | 237 | ||
| aa) Festkaufpreis (Locked Box-Methode) | 237 | ||
| bb) Kaufpreisanpassung durch Stichtagsbilanz („Completion Accounts“) | 238 | ||
| (1) Funktionsweise der Kaufpreisanpassung | 238 | ||
| (2) Doppelkompensation an Beispielfällen | 239 | ||
| b) Eigenkapitalgarantie vs. Bilanzgarantie | 241 | ||
| c) Bilanzgarantie vs. Zustandsgarantie | 241 | ||
| B. Schadensersatz in der gesetzlichen Gewährleistung, §§ 437 Nr. 3, 634 Nr. 4 BGB | 242 | ||
| I. Geltung der §§ 249ff. BGB im Gewährleistungsrecht | 242 | ||
| 1. Grundsätzliche Unanwendbarkeit nach der Rechtsprechung | 242 | ||
| 2. Anwendbarkeit der §§ 249ff. BGB im Gewährleistungsrecht | 243 | ||
| a) Unterschiede des deliktischen und vertraglichen Schadensersatzanspruchs | 243 | ||
| b) Irrwege der Rechtsprechung | 244 | ||
| c) Anwendung der §§ 249ff. BGB | 247 | ||
| II. Mangelminderwert und Mängelbeseitigungskosten beim Schaden am Unternehmen | 249 | ||
| 1. Schadensersatz für falsche Bilanzangaben | 249 | ||
| a) Umsatz und Ertragsangaben | 249 | ||
| b) Kaufvertragliche Bilanzgarantie | 249 | ||
| aa) Nicht betriebsnotwendiges Vermögen | 250 | ||
| bb) Betriebsnotwendige Vermögensgüter | 251 | ||
| cc) Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 251 | ||
| 2. Verhältnismäßigkeitsschranke bei Mängeln am Unternehmenssubstrat | 252 | ||
| C. Schadensersatz aufgrund vorvertraglicher Pflichtverletzung (c.i.c.) | 253 | ||
| I. Konkurrenzverhältnis zur arglistigen Täuschung | 253 | ||
| II. Naturalrestitution, § 249 Abs. 1 BGB | 256 | ||
| 1. Vertragsaufhebung | 256 | ||
| a) Inhalt und Grenzen des Anspruchs | 256 | ||
| b) Bereicherungsrechtlicher Gegenanspruch des Verkäufers | 257 | ||
| 2. Hypothetisch vorteilhafter Vertrag | 258 | ||
| III. Geldentschädigung gemäß § 251 BGB | 259 | ||
| 1. Ausschluss der Vertragsaufhebung nach § 251 BGB (Tatbestandliches) | 259 | ||
| a) Wahlrecht zur Kaufpreisminderung anstatt Vertragsaufhebung | 259 | ||
| b) Kaufpreisminderung als Wertersatz (§ 251 BGB) für unerwünschten Vertrag | 261 | ||
| c) Verteidigung des Verkäufers gegen Vertragsaufhebung | 263 | ||
| 2. Umfang und Berechnungsweise der Geldentschädigung | 266 | ||
| a) Abweichung von der Differenzhypothese (normativer Schaden) | 266 | ||
| b) Berechnung der Kaufpreisminderung | 267 | ||
| aa) Vorrang der konkreten Kaufpreisberechnung | 267 | ||
| bb) Adäquate Bemessung der Kaufpreisminderung in Zweifelsfällen | 269 | ||
| IV. Vorteilsausgleichung, Aufwendungen, Konkurrenzen | 271 | ||
| 1. Vorteilsausgleichung | 271 | ||
| 2. Aufwendungen | 271 | ||
| 3. Konkurrenzen | 272 | ||
| D. Zusammenfassung des Kapitels | 273 | ||
| § 5 Schadensersatz aus Bilanzgarantien bei Unternehmenskäufen im englischen Recht | 280 | ||
| A. Das Konzept einer „gesetzlichen“ Kaufgewährleistung | 280 | ||
| B. Der Tatbestand der Bilanzgarantie | 285 | ||
| I. „Completion Accounts“ | 285 | ||
| 1. Abgrenzung zur Bilanzgarantie | 285 | ||
| 2. Anspruchskonkurrenz zur Bilanzgarantie | 286 | ||
| a) Problemstellung | 286 | ||
| b) Widersprüchlichkeit („Inconsistency“) | 287 | ||
| c) Restriktiver Anwendungsbereich der Vertragsauslegung | 288 | ||
| d) „Implied terms“ und „rule against duplication of loss“ | 289 | ||
| II. „The Accounts“ | 292 | ||
| 1. Die gesetzlichen Vorschriften | 292 | ||
| 2. Das „true and fair view“ Prinzip | 295 | ||
| 3. Veranschaulichung der Bilanzgarantieverletzung am Fallbeispiel | 299 | ||
| III. „Management Accounts“ | 303 | ||
| 1. Tatbestand und Interessenlage | 303 | ||
| 2. Auslegungsfragen | 304 | ||
| IV. Subjektiver vs. objektiver Schutzgehalt der Garantie | 307 | ||
| C. Rechtsfolgen | 309 | ||
| I. Bilanzangaben als vorvertragliche Aufklärungspflichtverletzung | 311 | ||
| II. Der vertragliche Schadensersatzanspruch | 316 | ||
| 1. Kaufpreis als Gradmesser des geschuldeten Unternehmenswertes | 317 | ||
| 2. Der tatsächliche Unternehmenswert | 318 | ||
| III. Zeitpunkt der Schadensberechnung | 320 | ||
| IV. Sonderfall Lion Nathan: Zukünftige Gewinne | 323 | ||
| D. Zusammenfassung des Kapitels | 324 | ||
| § 6 Die Haftung aus der Bilanzgarantie im Rechtsvergleich | 328 | ||
| A. Einführung | 328 | ||
| I. Rechtsklarheit durch Konvergenz der Haftungsvereinbarungen? | 328 | ||
| II. Methodisches | 331 | ||
| 1. Ziele des Rechtsvergleichs | 331 | ||
| 2. Methodik | 332 | ||
| a) Der Methodenkomplex der Rechtsvergleichung | 332 | ||
| b) Das nützliche Wesen der Methodenlehre | 333 | ||
| c) Anwendungsbereich der funktionalen Methode im Methodenpluralismus | 334 | ||
| B. Rechtsvergleich | 337 | ||
| I. Fragestellung | 337 | ||
| II. Haftungsinstitute | 337 | ||
| 1. Kaufgewährleistung | 337 | ||
| 2. Haftung für Aufklärungspflichtverletzungen | 339 | ||
| III. Probleme des Tatbestands | 341 | ||
| 1. Vergleich der Vertragsgestaltung | 341 | ||
| 2. Tatbestandliches | 343 | ||
| a) Objektiver vs. subjektiver Schutzgehalt | 343 | ||
| b) Saldierung positiver und negativer Fehler | 345 | ||
| IV. Die Rechtsfolgen | 345 | ||
| 1. Grundsatz der „restitutio integrum“ | 345 | ||
| 2. Ausgleich für Bilanzgarantieverletzungen | 346 | ||
| a) Werteinbuße | 346 | ||
| b) Berechnungsmaßstäbe | 347 | ||
| 3. Garantie für zukünftige Gewinne | 349 | ||
| 4. Zeitpunkt der Schadensberechnung | 351 | ||
| 5. Konkurrenz zwischen „Completion Accounts“ und Bilanzgarantie | 351 | ||
| C. Zusammenfassung des Kapitels | 352 | ||
| § 7 Schlussthesen mit Erläuterungen | 355 | ||
| A. Grundlagen (§ 1) | 355 | ||
| B. Haftung aus Garantien, Gewährleistung und Aufklärungspflichten (§ 2) | 356 | ||
| C. Grundsätze des Schadensersatzrechts (§ 3) | 358 | ||
| D. Schadensersatz aus Garantien, Gewährleistung und Aufklärungspflichten (§ 4) | 360 | ||
| E. Rechtsvergleichung (§ 5 – § 6) | 364 | ||
| Literaturverzeichnis | 366 | ||
| Stichwortverzeichnis | 396 |
