Die Wirkungsweise der Grundrechte im Privatrecht
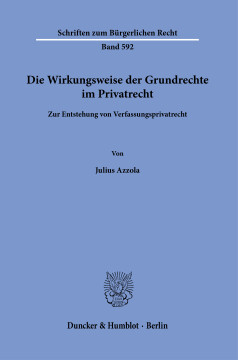
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Wirkungsweise der Grundrechte im Privatrecht
Zur Entstehung von Verfassungsprivatrecht
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 592
(2025)
Additional Information
Book Details
About The Author
Julius Azzola studierte Rechtswissenschaften an der Universität Konstanz. Nach dem Abschluss des 1. Staatexamens nahm er eine Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Michael Stürner, M. Jur. (Oxford) auf, bei dem er auch promovierte. Von August 2021 bis Juli 2022 absolvierte er ein LL.M. Studium an der Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. Im Anschluss legte er das Referendariat am Oberlandesgericht Karlsruhe ab mit Stationen in Konstanz, Stuttgart und München. Er ist derzeit als Rechtsanwalt in einer Corporate Boutique Kanzlei tätig.Abstract
Die Arbeit befasst sich mit dem zunehmenden Selbstverständnis der Verfassungsgerichte unter dem Deckmantel der Drittwirkung privatrechtliche Streitigkeiten an sich zu ziehen und als »Ersatzgesetzgeber das Privatrecht fortzubilden. Bei dieser Rechtsschöpfung entsteht - weitgehend unbemerkt - eine neue Ebene des Privatrechts: »Verfassungsprivatrecht«. Ausgangspunkt dieses ungeschriebenen Regelwerks ist die Bindungswirkung verfassungsgerichtlicher Entscheidungen. Verfassungsprivatrecht bindet neben der gesamten Zivilgerichtsbarkeit auch den Gesetzgeber. Einschlägige Rechtsprechungsbeispiele, etwa die Stadionverbotsentscheidung, werden meist nur mit Blick auf die Drittwirkungsmodelle untersucht. Die eigentliche Sprengkraft folgt jedoch aus den verbindlichen Vorgaben für die Zivilgerichtsbarkeit und den Gesetzgeber, die aus den Entscheidungen resultieren. Die Arbeit untersucht in welchen Fällen Verfassungsprivatrecht entsteht, inwieweit es bereits in geschriebener Form existiert und wie es sich in das bestehende Privatrechtssystem integrieren lässt.»Fundamental Rights and Private Law - The Emergence of Constitutional Private Law«: This thesis explores the emergence of a new layer of private law, which mainly stems from the case law of constitutional courts. It can be referred to as ›constitutional private law‹. While claiming that they are merely interpretating the constitution, constitutional courts effectively create and modify legal positions conferred on parties by private law. Their decisions can therefore be regarded as a source of private law. The thesis examines the extent to which constitutional private law can be integrated into the existing private law system.
