Das System der abhängigen Schöpfungen im digitalen Zeitalter – Eine Untersuchung am Beispiel von Internet-Memen
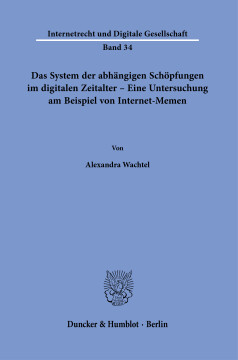
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Das System der abhängigen Schöpfungen im digitalen Zeitalter – Eine Untersuchung am Beispiel von Internet-Memen
Internetrecht und Digitale Gesellschaft, Vol. 34
(2022)
Additional Information
Book Details
About The Author
Alexandra Wachtel studierte Rechtswissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Im Rahmen dessen absolvierte sie den Begleitstudiengang »Anglo-American Law«, studierte ein Semester an der Université d’Avignon et des Pays de Vaucluses. Sie schloss ihr Studium 2016 mit der ersten juristischen Staatsprüfung ab. Im Anschluss arbeitete Alexandra Wachtel promotionsbegleitend am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Gewerblichen Rechtsschutz an der Universität Düsseldorf als wissenschaftliche Mitarbeiterin. 2020 begann sie ihr Referendariat in Düsseldorf und verbrachte Stationen beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, einer Wirtschaftskanzlei und bei ARTE in Straßburg.Abstract
Internet-Meme sind von digitalen Plattformen als Ausdrucksmittel gesellschaftlicher und politischer Partizipation nicht mehr wegzudenken. Als digitale referenzielle Kunstwerke greifen sie vorbekannte Werke und Werkelemente auf. Das Urheberrecht steht einem solchen »Aufsetzen« eigenen Werkschaffens auf fremde schöpferische Tätigkeit seit jeher offen gegenüber. Mit digitalen Techniken ist die gezielte und erkennbare Bezugnahme auf fremdes schöpferisches Schaffen zu einem beliebten Stilmittel der Remix-Kultur geworden. Es wirft die Frage auf, wo die Grenze eines eigenen schöpferischen Schaffensprozesses verläuft. Zur Beantwortung dieser Frage wird der urheberrechtliche Schöpfungsbegriff im Lichte der Kunstfreiheit untersucht. Im Fokus steht die Abgrenzung zwischen einer Vervielfältigung und einer abhängigen Bearbeitung einerseits und einem eigenständigen neuen Werk andererseits. Anhaltspunkte bieten die zu Parodien herausgebildeten und am Beispiel des Tonträgersamplings fortentwickelten Grundsätze.»Derivative Works in the Digital Age. An Examination of Internet-Memes«: The creation of a new work on the basis of a previously created work is a popular stylistic device of the digital remix culture. On the basis of Internet-memes, Alexandra Wachtel researches where the boundaries of an independent expressive creation lie in the light of artistic freedom. The focus is on the special features of digital referential works and the concept of creation under copyright law.
