Die Beschlussfeststellung im Verbandsrecht
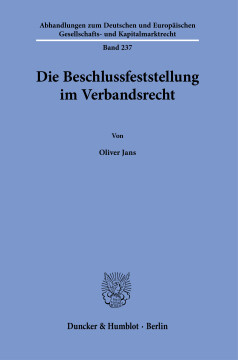
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Beschlussfeststellung im Verbandsrecht
Abhandlungen zum Deutschen und Europäischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Vol. 237
(2024)
Additional Information
Book Details
Pricing
About The Author
Der Autor hat Rechtswissenschaften an den Universitäten Trier und Bonn studiert. Seine Promotion hat er am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht sowie deutsches und internationales Unternehmens-, Wirtschafts- und Kartellrecht von Herrn Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M. (Yale) an der Universität Düsseldorf geschrieben. Das Rechtsreferendariat hat der Autor anschließend im OLG Bezirk Düsseldorf durchlaufen. Er ist spezialisiert im Gesellschaftsrecht.Abstract
Der Autor nimmt sich mit der Beschlussfeststellung im Verbandsrecht eines gesellschaftsrechtlichen Dauerbrenners an. In Gesellschaften müssen die Einzelmeinungen in einen Willen des Verbandes überführt werden, die Willensbildung der Gesellschaft erfolgt im Wege des Beschlusses. Hieran knüpft eine Vielzahl rechtlicher und praktischer Probleme. Die Arbeit befasst sich intensiv mit hochdogmatischen Fragestellungen, insbesondere mit der vom Autor so bezeichneten »Wirksamkeits- vs. Tatbestandslösung«. Es wird erarbeitet, weshalb ein Beschluss auch bei den (rechtsfähigen) Personengesellschaften stets dieser zugerechnet wird, also nicht wie z.T. noch angenommen ein Vertragsgeschehen der Gesellschafter untereinander ist. Der Autor bringt damit die heutige (durch das MoPeG gesetzlich unterfangene) Struktur der Personengesellschaften mit dem Beschlusswesen in Einklang. Abschließend befasst er sich mit den Modalitäten der Beschlussfeststellung und entwickelt ein kohärentes System.»Determination of Resolutions in the Law of Associations«: In companies, individual opinions must be transformed into the will of the association, and the will of the company is formed by means of a resolution. A large number of legal and practical problems are linked to this. A central anchor point is the determination of the result of the resolution, to which subsequent questions, such as the contestability and provisional effectiveness, are linked. The paper endeavors to systematize the issues across all associations.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 17 | ||
| Einleitung | 21 | ||
| A. Problemaufriss | 25 | ||
| B. Anliegen der Untersuchung | 27 | ||
| I. Beschlussfeststellung als Merkmal des Beschlusstatbestands? | 27 | ||
| II. Prozessuale Einbettung der Beschlussfeststellung | 29 | ||
| C. Terminologisches | 33 | ||
| D. Praktische Relevanz | 34 | ||
| E. Gang der Untersuchung | 35 | ||
| Erster Teil: Die Beschlussfeststellung im Verbandsrecht | 37 | ||
| § 1 Wirksamkeitslösung: Die Beschlussfeststellung in Rechtsprechung und herrschender Literatur | 37 | ||
| A. Unterscheidung von Tatbestand und Wirksamkeit als dogmatische Kategorien | 38 | ||
| I. Arten der Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäfts nach bürgerlichem Recht | 39 | ||
| II. Zur Unwirksamkeit von Beschlüssen im Gesellschaftsrecht | 42 | ||
| III. Fazit: Behandlung der Beschlussfeststellung auf Wirksamkeitsebene | 45 | ||
| B. Wirksamkeitsvoraussetzung und inhaltsfixierende Wirkung | 47 | ||
| I. Bedeutung für die Wirksamkeit des Beschlusses | 47 | ||
| II. Inhaltsfixierende Wirkung der Beschlussfeststellung | 49 | ||
| III. Umfang der inhaltsfixierenden Wirkung | 55 | ||
| C. Fehlerquellen bei der Beschlussfeststellung | 57 | ||
| I. Feststellungen zu den Anforderungen an den Beschluss | 58 | ||
| II. Feststellungen bei Komplikationen (auslegungsbedürftige Stimmabgaben, treuwidrige Stimmabgaben sowie Stimmverbote) | 59 | ||
| III. Fazit | 61 | ||
| D. Beschlussfeststellung in einzelnen Gesellschaftsformen | 62 | ||
| I. Aktiengesellschaft | 62 | ||
| 1. Die Regelung im Aktienrecht | 62 | ||
| 2. Entwicklung der Rechtsprechung | 66 | ||
| a) Konstitutive Bedeutung der Beschlussfeststellung | 66 | ||
| b) Inhaltsfixierende Wirkung der Beschlussfeststellung | 67 | ||
| aa) Negativ verkündete Beschlüsse (positive Beschlüsse) | 67 | ||
| bb) Positiv verkündete Beschlüsse (negative Beschlüsse) | 69 | ||
| 3. Wirkungen der Beschlussfeststellung | 71 | ||
| 4. Offene Flanken der Beschlussfeststellung | 72 | ||
| a) Unsicherheit über die Person des Versammlungsleiters | 72 | ||
| b) Sonderfall: Mehrheit von Versammlungsleitern | 74 | ||
| c) Feststellung offenlassen? | 75 | ||
| II. Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 77 | ||
| 1. Die Regelung im GmbH-Recht | 77 | ||
| 2. Entwicklung der Rechtsprechung | 82 | ||
| a) Konstitutive Bedeutung der Beschlussfeststellung | 82 | ||
| b) Inhaltsfixierende Wirkung der Beschlussfeststellung | 83 | ||
| aa) Positiv verkündete Beschlüsse (negative Beschlüsse) | 83 | ||
| bb) Negativ verkündete Beschlüsse (positive Beschlüsse) | 85 | ||
| cc) Grundlagenurteil von 1988 | 86 | ||
| 3. Wirkungen der Beschlussfeststellung | 87 | ||
| 4. Offene Flanken der Beschlussfeststellung | 87 | ||
| a) Unsicheres Fundament der aktienrechtlichen Analogie | 89 | ||
| aa) Funktionales Defizit der Beschlussfeststellung durch einen Versammlungsleiter | 89 | ||
| bb) Weitere Beschlussfixierungsmöglichkeiten | 90 | ||
| cc) Ausnahmen von der fixierenden Wirkung der Beschlussfeststellung | 92 | ||
| b) Unsicherheiten bei der Beschlussfeststellungskompetenz | 94 | ||
| aa) Fehlende Gewährleistung der Unabhängigkeit | 94 | ||
| bb) Fehlerrisiken bei Stimmauswertung | 95 | ||
| cc) Missbrauch von Stimmrechtsmacht | 95 | ||
| dd) Fehlende gesetzliche Legitimation der Beschlussfeststellung | 96 | ||
| c) Unsicherheit über die Person des Versammlungsleiters und Mehrheit von Versammlungsleitern | 98 | ||
| d) Zusammenfassung | 98 | ||
| III. Wohnungseigentümergemeinschaft | 98 | ||
| 1. Die Regelung im Wohnungseigentumsrecht | 98 | ||
| 2. Entwicklung der Rechtsprechung | 101 | ||
| a) Ältere Rechtsprechung | 101 | ||
| b) Grundsatzbeschluss des BGH v. 23.08.2001 | 103 | ||
| 3. Wirkungen der Beschlussfeststellung | 104 | ||
| a) Konstitutive Bedeutung und inhaltsfixierende Wirkung | 104 | ||
| b) Beschlussverkündung als Tatbestands- oder Wirksamkeitsvoraussetzung | 105 | ||
| 4. Offene Flanken der Beschlussfeststellung | 107 | ||
| a) Unterbliebene Beschlussfeststellung | 107 | ||
| b) Fälle konkludenter Beschlussfeststellung | 109 | ||
| IV. Genossenschaft | 111 | ||
| V. Verein | 114 | ||
| 1. Die Regelung im Vereinsrecht | 114 | ||
| 2. Exkurs zur Bedeutung des Beschlussergebnisses im abgestuften Nichtigkeitskonzept des Vereinsrechts | 116 | ||
| VI. Personengesellschaften | 119 | ||
| 1. Beschlussfeststellung nach aktueller Rechtslage | 119 | ||
| 2. Beschlussfeststellung nach Inkrafttreten des MoPeG zum 01.01.2024 | 122 | ||
| E. Prozessuale Implikationen | 124 | ||
| I. Kassatorisches Beschlussmängelrecht | 125 | ||
| 1. Förmlich festgestellter Beschluss | 125 | ||
| 2. Unterbliebene Beschlussfeststellung | 127 | ||
| II. Allgemeines Beschlussmängelrecht | 129 | ||
| F. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse | 129 | ||
| § 2 Tatbestandslösung: Die Lehre vom Beschluss als Organakt und allgemeines Beschlussrecht | 132 | ||
| A. Die Lehre vom Beschluss als Organakt | 133 | ||
| B. Skauradszuns allgemeines Beschlussrecht | 135 | ||
| C. Prozessuale Implikationen | 137 | ||
| I. Kassatorisches Beschlussmängelrecht | 137 | ||
| 1. Förmlich festgestellter Beschluss | 137 | ||
| 2. Unterbliebene Beschlussverkündung | 139 | ||
| II. Allgemeines Beschlussmängelrecht | 139 | ||
| D. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse | 141 | ||
| Zweiter Teil: Beschlussfeststellung und Beschlussdogmatik | 143 | ||
| § 3 Die Zweispurigkeit des Beschlussrechts | 143 | ||
| A. Die dichotome Entwicklung von juristischer Person und Gesamthand | 144 | ||
| B. Schuldrechtliche und organschaftliche Beschlussdogmatik | 148 | ||
| I. Die organschaftliche Beschlussdogmatik nach v. Gierke | 148 | ||
| II. Die schuldrechtliche Beschlussdogmatik nach v. Tuhr | 149 | ||
| C. Folgen der jeweiligen Beschlussdogmatik | 156 | ||
| I. Rechtsträger des Beschlusses | 156 | ||
| 1. Organschaftliche Beschlussfassung | 156 | ||
| 2. Schuldrechtliche Beschlussfassung | 156 | ||
| II. Passivlegitimation bei Beschlussklagen | 158 | ||
| 1. Organschaftliche Beschlussfassung | 158 | ||
| 2. Schuldrechtliche Beschlussfassung | 160 | ||
| III. Beschlussmängelrecht | 161 | ||
| 1. Organschaftliche Beschlussfassung | 161 | ||
| 2. Schuldrechtliche Beschlussfassung | 161 | ||
| IV. Negativbeschlüsse | 163 | ||
| 1. Organschaftliche Beschlussfassung | 163 | ||
| 2. Schuldrechtliche Beschlussfassung | 163 | ||
| V. Einpersonen-Beschlüsse | 164 | ||
| 1. Organschaftliche Beschlussfassung | 164 | ||
| 2. Schuldrechtliche Beschlussfassung | 164 | ||
| VI. Die Beschlussfeststellung als Tatbestandsmerkmal? | 165 | ||
| 1. Organschaftliche Beschlussfassung | 165 | ||
| 2. Schuldrechtliche Beschlussfassung | 165 | ||
| D. Die Rechtsnatur des Beschlusses | 165 | ||
| I. Der Einfluss der Begriffsjurisprudenz | 167 | ||
| II. Die Beschlussbegriffe im Einzelnen | 168 | ||
| 1. Der Beschluss als Rechtsgeschäft eigener Art nach v. Tuhr und herrschender Meinung | 170 | ||
| 2. Der Beschluss als Vertrag | 173 | ||
| a) Der einstimmige Beschluss bei den Personengesellschaften | 173 | ||
| b) Mehrheitsbeschlüsse bei den Personengesellschaften | 174 | ||
| c) Beschlüsse von juristischen Personen | 174 | ||
| 3. Der Beschluss als Organakt | 175 | ||
| III. Überwindung des v. Tuhr'schen Beschlussbegriffes im Körperschaftsrecht | 176 | ||
| 1. Keine Hilfskonstruktionen im Körperschaftsrecht | 176 | ||
| 2. Verselbstständigung der Körperschaften auch im Binnenverhältnis | 177 | ||
| 3. Integration der Organtheorie in das Beschlussrecht | 179 | ||
| 4. Bindungswirkung negativer Beschlüsse | 181 | ||
| 5. Ergebnis: Aufgabe des Begriffs „Rechtsgeschäft eigener Art“? | 182 | ||
| § 4 Organschaftliche Beschlusszurechnung im Personengesellschaftsrecht | 183 | ||
| A. Anerkennung einer organschaftlichen Beschlussdogmatik nach bisheriger Ansicht | 184 | ||
| I. Organschaftliche Beschlussdogmatik bei Geschäftsführungsbeschlüssen | 187 | ||
| II. Änderung des Gesellschaftsvertrags | 188 | ||
| 1. Grundsatz: Schuldrechtliche Beschlussfassung bei den Personengesellschaften | 188 | ||
| 2. Das Problem der Mehrheitsbeschlüsse | 191 | ||
| a) Theorie der antizipierten Zustimmung | 192 | ||
| b) Gestaltungsmacht-Theorie | 193 | ||
| c) Mehrheitsprinzip keine taugliche Abgrenzung | 194 | ||
| 3. Fakultative Einführung der organschaftlichen Beschlussdogmatik | 196 | ||
| 4. Auslegungskriterien | 198 | ||
| a) Realstruktur der Gesellschaft | 198 | ||
| b) Körperschaftliche Ausgestaltung im Gesellschaftsvertrag | 200 | ||
| III. Grundlagenbeschlüsse | 201 | ||
| 1. Organhandeln: Beschlüsse in gemeinsamen Fragen der Gesamthand | 202 | ||
| 2. Handeln als Vertragspartner: Grundlagenbeschlüsse mit Vertragsnähe | 204 | ||
| 3. Bewertung | 205 | ||
| IV. Zwischenergebnis | 208 | ||
| B. Übergang zur organschaftlichen Beschlussdogmatik | 210 | ||
| I. Verselbstständigung des Rechtsträgers nach innen | 210 | ||
| 1. Die fehlende körperschaftliche Binnenstruktur der Personengesellschaften als Einwand gegen die Verselbstständigung nach innen? | 211 | ||
| 2. Das Vertragsprinzip als Einwand gegen die Verselbstständigung nach innen? | 216 | ||
| a) Das Vertragsprinzip nach herrschender Meinung | 216 | ||
| b) Relativierung des Vertragsprinzips im geltenden Recht | 218 | ||
| c) Aus Vertragsfreiheit wird Verbandsautonomie | 221 | ||
| 3. Die Rechtsnatur des Gesellschaftsvertrags als Einwand gegen die Verselbstständigung nach innen? | 223 | ||
| a) Aufgabe des Gesellschaftsvertrags als typengemischt schuldrechtlicher und organisationsrechtlicher Vertrag | 223 | ||
| b) Die Grundlagenfunktion des Gesellschaftsvertrags | 229 | ||
| c) Grundlagenfunktion für alle Personengesellschaften? | 233 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 236 | ||
| II. Folgen für das Beschlussrecht der Personengesellschaften | 237 | ||
| 1. Träger des Beschlusses | 237 | ||
| 2. Passivlegitimation | 237 | ||
| 3. Anfechtungsklageerfordernis? | 238 | ||
| a) Personenhandelsgesellschaften nach dem MoPeG | 239 | ||
| b) Rechtsfähige BGB-Gesellschaft nach dem MoPeG | 239 | ||
| c) Erga-omnes-Wirkung | 239 | ||
| 4. Kostenlast | 240 | ||
| 5. Minderheitenschutz | 241 | ||
| 6. Einpersonen-Beschlüsse | 241 | ||
| C. Schuldrechtliche Beschlussdogmatik bei den nichtrechtsfähigen Innengesellschaften | 242 | ||
| § 5 Die Beschlussfeststellung als hinzutretender Akt | 246 | ||
| A. Das dogmatische Argument | 246 | ||
| B. Das funktionale Argument | 250 | ||
| C. Das historische Argument | 251 | ||
| D. Das prozessuale Argument | 252 | ||
| E. Die Rechtslage im Vereinsrecht | 254 | ||
| § 6 Die Beschlussmängelsysteme im Überblick | 256 | ||
| A. Das Anfechtungsmodell | 257 | ||
| I. Inhalt | 257 | ||
| II. Beschlussfeststellung als Funktionsvoraussetzung der Anfechtungsklage | 258 | ||
| B. Das schuldrechtliche Feststellungsmodell (Nichtigkeitsgrundsatz) | 260 | ||
| I. Inhalt | 260 | ||
| II. Beschlussfeststellung bedeutungslos | 261 | ||
| C. Das organschaftliche Feststellungsmodell (Nichtigkeitsgrundsatz) nach vereinsrechtlichem Vorbild | 262 | ||
| I. Inhalt | 262 | ||
| II. Beschlussfeststellung bedeutungslos | 264 | ||
| Dritter Teil: Leitlinien der Beschlussfixierung | 265 | ||
| § 7 Beschlussfixierung in der GmbH | 266 | ||
| A. Prämisse: Keine Marginalisierung der Anfechtungsklage | 268 | ||
| B. Beschlussfixierung durch Feststellung des Versammlungsleiters | 268 | ||
| I. Die Problemfälle | 269 | ||
| II. Wahl des Versammlungsleiters | 270 | ||
| III. Die Feststellungskompetenz des Versammlungsleiters | 272 | ||
| 1. Meinungsstand in der Literatur – Beschluss des KG v. 12.10.2015 – Ansatz des BGH | 272 | ||
| 2. BGH v. 04.05.2009 – Feststellungsbefugnis bei einfacher Wahlmehrheit | 275 | ||
| 3. BGH v. 21.06.2010 – Feststellungsbefugnis des statutarisch bestimmten Versammlungsleiters | 276 | ||
| 4. BGH v. 20.11.2018 – Beschlussfeststellung durch den faktischen Versammlungsleiter | 276 | ||
| 5. Gründe für die Regel-Feststellungskompetenz des Versammlungsleiters | 277 | ||
| a) Vorrang der §§ 241ff. AktG analog vor der Feststellungsklage gem. § 256 ZPO | 277 | ||
| b) Vermeidung der Ausdehnung des Beschlussmängel-Rechtsstreits auf Fehler bei der Versammlungsleitung | 279 | ||
| c) Erklärungsbewusstsein der Gesellschafter bezüglich einer Übertragung der Beschlussfeststellungskompetenz? | 281 | ||
| IV. Beschlussfeststellung bei parallelen Gesellschafterversammlungen – Stimmverbote bei der Versammlungsleiterwahl oder -abwahl | 282 | ||
| V. Willkürliche oder absichtlich falsche Beschlussfeststellung | 285 | ||
| C. Beschlussfixierung durch den faktischen Versammlungsleiter | 287 | ||
| I. Der Fixierungstatbestand – BGH v. 20.11.2018 – beschränkte Wirkung eines Widerspruchs | 287 | ||
| II. Abgrenzung des „faktischen Versammlungsleiters“ vom „angemaßten Versammlungsleiter“ | 291 | ||
| D. Beschlussfixierung durch Konsens | 293 | ||
| I. Herausarbeitung des (positiven) Fixierungstatbestands: Konsens der Versammlungsteilnehmer | 294 | ||
| II. (Qualifiziertes) Widerspruchserfordernis | 298 | ||
| III. Auffangtatbestand und „Grundfall“ | 301 | ||
| E. Beschlussfixierung beim Wahlbeschluss zum Versammlungsleiter | 303 | ||
| F. Zusammenfassung | 304 | ||
| § 8 Übertragbarkeit auf die Personengesellschaften nach dem MoPeG | 305 | ||
| A. Vereinbarkeit mit dem Einstimmigkeitsprinzip | 307 | ||
| B. Vereinbarkeit bei Geltung einer Mehrheitsklausel | 308 | ||
| § 9 Übertragbarkeit auf die Aktiengesellschaft | 309 | ||
| A. Beschlussfixierung durch Konsens? | 309 | ||
| B. Der Scheinaufsichtsratsvorsitzende und Mehrheit von Versammlungsleitern | 310 | ||
| § 10 Übertragbarkeit auf die Wohnungseigentümergemeinschaft und Genossenschaft | 311 | ||
| § 11 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse | 313 | ||
| Literaturverzeichnis | 318 | ||
| Sachwortverzeichnis | 337 |
