Die zweckoffene Personengesellschaft
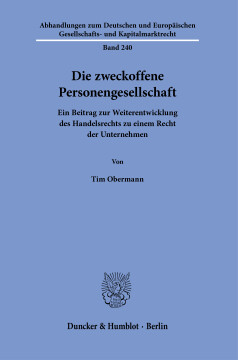
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die zweckoffene Personengesellschaft
Ein Beitrag zur Weiterentwicklung des Handelsrechts zu einem Recht der Unternehmen
Abhandlungen zum Deutschen und Europäischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Vol. 240
(2024)
Additional Information
Book Details
Pricing
About The Author
Tim Obermann studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Heidelberg und Madrid mit dem Schwerpunkt Europa- und Wirtschaftsrecht. Im Anschluss promovierte er am Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht in Heidelberg bei Professor Dr. Christoph A. Kern, LL.M. (Harvard). Während dieser Zeit war er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl seines Doktorvaters und später im Bundesministerium der Justiz tätig. Sein Referendariat absolvierte er am Kammergericht in Berlin. Seit Oktober 2025 ist er als Rechtsanwalt bei RAUE in Berlin tätig.Abstract
Am 1. Januar 2024 ist das MoPeG in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurden die §§ 705 ff. BGB grundlegend modernisiert. Die Reform des Personengesellschaftsrechts ist damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Denn der längst überholte Kaufmannsbegriff blieb ebenso erhalten wie die Trennung der Personengesellschaften nach Maßgabe des von ihnen verfolgten Zwecks. Um langfristig das Handelsrecht zu einem Sonderprivatrecht der Unternehmen zu entwickeln, plädiert der Autor dafür, mittelfristig eine zweckoffene Personengesellschaft nach österreichischem Vorbild zu schaffen. Sie soll allen erlaubten Zwecken offenstehen und erst mit Eintragung im Register entstehen. In seiner Arbeit hinterfragt der Autor unter anderem die »Verhandelsgesellschaftung« der GbR, setzt sich kritisch mit dem Prinzip der freien Rechtsträgerbildung auseinander und moniert die Privilegierung freiberuflicher Unternehmen im Handelsrecht.»The Open-Purpose Partnership. A Contribution to Further Developing Commercial Law into a Law of Companies«: With the MoPeG coming into effect, the legislature has fundamentally modernized the law governing partnerships. Despite the new implementation, the distinction between partnerships in regard to the purpose they pursue remained unaltered. This thesis questions the concept of a merchant and argues in favor of creating a partnership with an open purpose approach in the medium term, which only comes into existence only through entry in a register.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsübersicht | 9 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 11 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 17 | ||
| § 1 Einführung und Grundlagen | 21 | ||
| A. Einführung | 21 | ||
| B. Grundlagen | 24 | ||
| I. Die GbR als Grundform der Personengesellschaften | 25 | ||
| 1. Flexibilität des Regelungsgerüsts | 25 | ||
| 2. Subsidiäre Geltung des GbR-Rechts | 27 | ||
| 3. Möglichkeit identitätswahrender Rechtsformwechsel | 28 | ||
| 4. Auffangrechtsform für Gesellschaften ausländischen Rechts | 30 | ||
| 5. Vorgründungsgesellschaft | 31 | ||
| II. Vielfältige Erscheinungsformen | 32 | ||
| 1. Zwei Strukturtypen unter einem Dach | 33 | ||
| 2. Innengesellschaften | 34 | ||
| 3. Außengesellschaften | 37 | ||
| 4. Zwischenfazit | 39 | ||
| III. Zusammenfassung | 39 | ||
| § 2 Reform im bestehenden System durch das MoPeG | 41 | ||
| A. Leitbildwandel der Gesellschaft bürgerlichen Rechts | 41 | ||
| I. Leitbilder im Recht | 42 | ||
| II. Vom Schuldverhältnis zum Rechtssubjekt | 44 | ||
| 1. Historische Konzeption der GbR | 44 | ||
| 2. Rechtsfortbildung durch den BGH | 45 | ||
| 3. Konsolidierung des GbR-Rechts durch das MoPeG | 47 | ||
| III. Vom Sondervermögen der Gesellschafter zum Gesellschaftsvermögen | 48 | ||
| 1. Das Wesen der Gesamthand | 48 | ||
| 2. Vom Anteil am Gesellschaftsvermögen zum Anteil an der Gesellschaft | 49 | ||
| 3. Das Anwachsungsprinzip | 51 | ||
| 4. Abschied vom Gesamthandsprinzip im Gesellschaftsrecht | 52 | ||
| IV. Von der Haftung der Gesellschafter zur Haftung der Gesellschaft | 53 | ||
| 1. Gesellschaftsschuld und Gesellschafterhaftung | 53 | ||
| 2. Doppelverpflichtungstheorie | 54 | ||
| 3. Akzessorietätstheorie | 54 | ||
| 4. Kodifizierung der BGH-Rechtsprechung durch das MoPeG | 56 | ||
| V. Vom Vertrag zur Organisation | 57 | ||
| 1. Trennung von Beschlussfassung und Geschäftsführung | 57 | ||
| a) Die reformbedürftigen §§ 709–711 BGB a. F. | 58 | ||
| b) Die reformierten §§ 714 und 715 BGB | 59 | ||
| 2. Vom Selbsthandeln der Gesamthand zur organschaftlichen Vertretung | 61 | ||
| a) Der reformbedürftige § 714 BGB a. F. | 61 | ||
| b) Organtheorie | 62 | ||
| c) Der neu gefasste § 720 BGB | 63 | ||
| VI. Von der Gelegenheits- zur Dauergesellschaft | 64 | ||
| 1. § 708 BGB a. F. | 65 | ||
| 2. § 709 Absatz 3 BGB | 66 | ||
| 3. § 723 Absatz 1 BGB | 68 | ||
| 4. § 725 Absatz 1 BGB | 69 | ||
| VII. Vom publizitätslosen Rechtssubjekt zur eingetragenen GbR | 69 | ||
| 1. Rechtsunsicherheiten mangels Registerpublizität | 70 | ||
| a) Die GbR im Grundstücksrechtsverkehr | 72 | ||
| b) Die GbR als Gesellschafterin | 74 | ||
| c) Die GbR im Zivilprozess | 75 | ||
| 2. Einführung eines Gesellschaftsregisters durch das MoPeG | 75 | ||
| 3. Verbleibendes Publizitätsdefizit | 77 | ||
| VIII. Zusammenfassung | 78 | ||
| B. Handelsrecht als Sonderprivatrecht der Kaufleute | 79 | ||
| I. Der Kaufmannsbegriff | 79 | ||
| 1. Kaufmann kraft Betrieb eines Handelsgewerbes | 80 | ||
| 2. Kaufmann kraft Eintragung | 82 | ||
| II. Die Handels-Personengesellschaften | 83 | ||
| 1. Ist-oHG kraft Betrieb eines Handelsgewerbes | 83 | ||
| 2. Kann-oHG kraft Eintragung | 84 | ||
| a) Kleingewerbetreibende, Land- und Forstwirte, Vermögensverwaltung | 84 | ||
| b) Grenzen der Vermögensverwaltung | 86 | ||
| aa) Meinungsspektrum | 86 | ||
| bb) Stellungnahme | 87 | ||
| 3. Zwischenfazit | 89 | ||
| III. Handelsgesellschaften und Kaufmannsrecht | 89 | ||
| 1. Handels-Personengesellschaften | 90 | ||
| 2. Kapital-Handelsgesellschaften | 91 | ||
| C. Eintragungsoption für freie Berufe | 91 | ||
| I. Begriff des „Freiberuflers“ | 92 | ||
| II. Eintragungswahlrecht für Angehörige der freien Berufe | 93 | ||
| III. Vorbehalt des Berufsrechts | 94 | ||
| 1. Gesellschaftsrecht und Berufsrecht | 95 | ||
| 2. Wirkungsweise des Berufsvorbehalts | 96 | ||
| IV. Ausstrahlungswirkungen der Öffnung | 97 | ||
| D. Motive | 98 | ||
| § 3 Systemwechsel in Österreich | 101 | ||
| A. Vom Handels- zum Unternehmensgesetzbuch | 101 | ||
| B. Wesentliche Reforminhalte | 103 | ||
| I. Vom Kaufmann zum Unternehmer | 103 | ||
| 1. Unternehmer kraft Betrieb eines Unternehmens | 103 | ||
| 2. Unternehmer kraft Rechtsform | 104 | ||
| 3. Unternehmer kraft Eintragung | 105 | ||
| 4. Scheinunternehmer | 105 | ||
| II. Von der Handelsgesellschaft zur Offenen Gesellschaft | 105 | ||
| III. Einführung des Normativsystems | 107 | ||
| C. Kritik und Bewertung | 107 | ||
| I. Sinnvolle Erweiterung des Grundtatbestands | 108 | ||
| II. Gelungene Neuausrichtung der Personengesellschaften | 109 | ||
| III. Rechtssicherheit durch konstitutive Eintragung | 110 | ||
| § 4 Vorschlag einer zweckoffenen Personengesellschaft | 111 | ||
| A. Zweckoffener Grundtatbestand | 112 | ||
| I. Folgerichtigkeit | 112 | ||
| 1. Vom Handels- zum Unternehmensrecht | 112 | ||
| a) Das Handelsrecht als Kaufmannsrecht | 113 | ||
| b) Das Unternehmensmodell als Gegenentwurf | 113 | ||
| aa) Rechtsfortbildung de lege lata | 116 | ||
| bb) Rechtsfortbildung de lege ferenda | 118 | ||
| cc) Würdigung | 120 | ||
| c) Die Rechtsentwicklung in Deutschland und Europa | 122 | ||
| aa) Nationale Entwicklungslinien | 123 | ||
| bb) Europäische Harmonisierung des Privatrechts | 125 | ||
| 2. Eintragungsoption für Freiberufler | 128 | ||
| a) Gewerbetreibende und Freiberufler | 128 | ||
| b) Öffnung des Grundtatbestands | 130 | ||
| 3. Schritt-für-Schritt-Rechtspolitik | 131 | ||
| II. Sachgerechtigkeit | 133 | ||
| 1. Überschießende Regelungen | 133 | ||
| a) Rechtsangleichung | 134 | ||
| b) Keine Haftungserleichterung | 135 | ||
| c) Würdigung | 137 | ||
| aa) Aufgabe der GbR als Grundform? | 137 | ||
| bb) Eingeschränkte Rechtsformwahlfreiheit | 139 | ||
| 2. Unzureichende Regelungen | 142 | ||
| a) Verbleibende Unterschiede zwischen GbR und oHG | 142 | ||
| aa) Eintragung | 143 | ||
| bb) Geschäftsführung und Vertretung | 143 | ||
| cc) Beschlussmängelrecht | 144 | ||
| dd) Wettbewerbsverbot | 145 | ||
| ee) Kündigungs- und Auflösungsgründe | 146 | ||
| ff) Gestaltungsklageerfordernis | 147 | ||
| gg) Jahresabschluss und Liquidation | 148 | ||
| b) Würdigung | 148 | ||
| aa) Eintragung | 149 | ||
| bb) Geschäftsführung und Vertretung | 150 | ||
| cc) Beschlussmängelrecht | 150 | ||
| dd) Wettbewerbsverbot | 152 | ||
| ee) Kündigung des Gesellschafter-Erben | 154 | ||
| ff) Gestaltungsklageerfordernis | 154 | ||
| 3. Rückbesinnung und Fortschritt | 156 | ||
| III. Rechtssicherheit | 158 | ||
| 1. Anwendung von Sonderprivatrecht | 158 | ||
| 2. Betrieb eines Handelsgewerbes | 159 | ||
| a) Erforderlichkeit | 159 | ||
| b) In kaufmännischer Weise | 160 | ||
| c) Art oder Umfang | 161 | ||
| d) Beweislastumkehr | 161 | ||
| 3. Betrieb eines Unternehmens | 162 | ||
| 4. Zusammenfassung und Würdigung | 163 | ||
| B. Gleichlauf von Rechtsfähigkeit und Registereintragung | 165 | ||
| I. Abgrenzung von Innen- und Außengesellschaft | 166 | ||
| 1. Innen- und Außengesellschaft | 166 | ||
| 2. Bestimmung der Rechtsfähigkeit | 167 | ||
| 3. Abgrenzungsschwierigkeiten | 170 | ||
| a) Divergierender Wille | 170 | ||
| b) Wechselnder Wille | 172 | ||
| c) Fehlender Wille | 172 | ||
| II. Vorzüge einer konstitutiven Eintragung | 174 | ||
| 1. Vollständige Subjektpublizität | 174 | ||
| a) Erkenntnisverfahren | 175 | ||
| b) Zwangsvollstreckung | 177 | ||
| 2. Transparenter Vermögensübergang | 180 | ||
| a) Beschluss zur Teilnahme am Rechtsverkehr | 181 | ||
| aa) Einzelrechtsnachfolge in Deutschland | 182 | ||
| bb) Partielle Gesamtrechtsnachfolge in Österreich | 183 | ||
| b) Rückkehr in die nicht rechtsfähige Gesellschaft | 185 | ||
| aa) Auflösung und Neugründung in Deutschland | 185 | ||
| bb) Einzelrechtsnachfolge auch in Österreich? | 186 | ||
| c) Konstitutive Eintragung als Chance zur Gesamtrechtsnachfolge | 190 | ||
| 3. Keine Rechtsfähigkeit nolens volens | 193 | ||
| III. Keine durchgreifenden Bedenken | 195 | ||
| 1. Wegfall der (Außen-)GbR als publizitätsloses Rechtssubjekt | 196 | ||
| a) Kostensteigerung | 196 | ||
| b) Reputationsgewinn und Einspareffekte | 197 | ||
| c) Ausweichverhalten der Gesellschafter | 199 | ||
| d) Zusammenfassung und Bewertung | 199 | ||
| 2. Handlungen der Gesellschafter zwischen Gründung und Entstehung | 200 | ||
| a) Rechtsnatur der Vor-Gesellschaft | 200 | ||
| b) Berechtigung und Verpflichtung der Gesellschafter | 201 | ||
| c) Vermögensordnung in der Vor-Gesellschaft | 202 | ||
| d) Eintritt in die Rechtsverhältnisse der Vor-Gesellschaft | 202 | ||
| e) Zusammenfassung und Bewertung | 202 | ||
| 3. Bestandsschutz für publizitätslose Rechtssubjekte | 203 | ||
| a) Übergangsrecht | 203 | ||
| b) Bewertung | 204 | ||
| C. Bereichsausnahmen | 205 | ||
| I. Unternehmensgegenstand | 205 | ||
| 1. Sonderstellung der freien Berufe, Land- und Forstwirte | 206 | ||
| 2. Würdigung | 207 | ||
| II. Unternehmensgröße | 210 | ||
| 1. Anfängliche Differenzierung | 210 | ||
| 2. Nachträgliche Differenzierung | 212 | ||
| 3. Würdigung | 213 | ||
| § 5 Fazit und Empfehlungen | 215 | ||
| A. Deutsche Reform im bestehenden System | 215 | ||
| B. Vom Handels- zum Unternehmensrecht in Österreich | 216 | ||
| C. Die zweckoffene Personengesellschaft | 218 | ||
| Literatur- und Quellenverzeichnis | 219 | ||
| Stichwortverzeichnis | 240 |
