Rechtsschutz der Aktionäre der Zielgesellschaft bei unterlassenem Pflichtangebot nach § 35 WpÜG
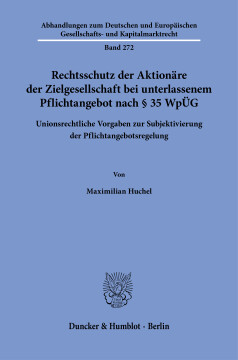
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Rechtsschutz der Aktionäre der Zielgesellschaft bei unterlassenem Pflichtangebot nach § 35 WpÜG
Unionsrechtliche Vorgaben zur Subjektivierung der Pflichtangebotsregelung
Abhandlungen zum Deutschen und Europäischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Vol. 272
(2025)
