Digital Health und Recht
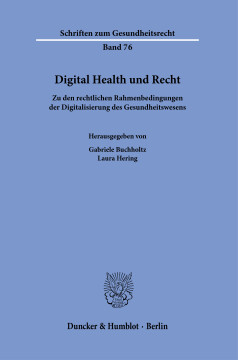
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Digital Health und Recht
Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens
Editors: Buchholtz, Gabriele | Hering, Laura
Schriften zum Gesundheitsrecht, Vol. 76
(2024)
Additional Information
Book Details
About The Author
Dr. Laura Hering, LL.M. (Brügge), Studium der Rechtswissenschaft in Hamburg und Paris; erste juristische Staatsprüfung (2011); Referendariat am Hanseatischen OLG mit Stationen u.a. am Europäischen Gerichtshof, Luxemburg; der Europäischen Kommission, Brüssel; zweite juristische Staatsprüfung (2014); LL.M. am Collège d’Europe in Brügge (2015); Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg; Forschungsaufenthalt an der University of Cambridge (2017); Promotion (2018) in Hamburg; seit 2018 Referentin und Habilitandin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg.Jun.-Prof. Dr. Gabriele Buchholtz, Studium der Rechtswissenschaft an der Bucerius Law School in Hamburg und an der Fordham Law School in New York (USA); erste juristische Staatsprüfung (2011); wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promotion zum Thema »Streiken im Europäischen Grundrechtsgefüge« (2014) an der Bucerius Law School; Referendariat am Hanseatischen OLG mit Stationen u.a. am Bundesverfassungsgericht, OLG Hamburg und Gleiss Lutz; zweite juristische Staatsprüfung (2016); wissenschaftliche Assistentin und Habilitandin an der Bucerius Law School (2016 bis 2020); Juniorprofessorin für das Recht der sozialen Sicherung mit dem Schwerpunkt in Digitalisierung und Migration an der Universität Hamburg (seit 2020).Abstract
Die Digitalisierung im Gesundheitssektor hat in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Der Band nähert sich diesem Thema aus der rechtlichen Perspektive, die um Beiträge aus der Ethik und Bioinformatik angereichert wird. Der erste Themenbereich kreist um die elektronische Patientenakte (ePA). Der zweite Teil beschäftigt sich mit weiteren regulatorischen Innovationen, namentlich den digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs), digitalen Pflegeanwendungen (DiPAs), Entscheidungsunterstützungssystemen (CDSS) und Software als Medizinprodukt (SaMD). Sodann widmen sich die Beiträge den Querschnittsfragen der Solidarität und Individualisierung sowie der Haftung. Der fünfte und letzte Themenkomplex beschäftigt sich mit möglichen Lösungsansätzen für datenschutzrechtliche Probleme aus einer rechtlichen und informatisch informierten Perspektive. Dieser Band liefert einen Beitrag zur Sichtung und Systematisierung der zuweilen disparat anmutenden Rechtsmaterie. Zentral ist die Einsicht, dass das Recht im Bereich Digital Health interdisziplinär, kreativ, flexibel und innovationsfördernd sein und bleiben muss.»Digital Health and Law«: This volume approaches digital health from a legal perspective, enriched by contributions from the fields of ethics and bioinformatics. The electronic patient record and other regulatory innovations such as digital health applications (DiGAs) are examined in detail. Issues of solidarity and individualisation, liability and privacy are also explored. The central finding of the volume is that digital health law needs to be interdisciplinary, creative, flexible and conducive to innovation.
Table of Contents
Chapters
Digital Health und Recht – Einführung in die Thematik
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 7–21
Die elektronische Patientenakte – Innovation für die Patientenversorgung oder gesetzgeberische Fehlkonstruktion?
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 25–43
Die elektronische Patientenakte (ePA) im europäischen Datenschutzrechtsvergleich
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 45–64
Datenschutz und Datennutzung im digitalen Gesundheitswesen
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 65–86
ePA, DiGA, SaMD & Co. – Regulatorische Trends und Entwicklungen einer datengetriebenen Medizin
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 89–126
Digitale Pflegeanwendung (DiPA) als neuer Baustein einer Digitalisierung des Gesundheitswesens
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 127–140
Zulassung KI-basierter Clinical Decision Support Systems unter der Medical Device Regulation
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 141–164
Die digitale Zukunft des Gesundheitswesens – Solidarität vs. Individualisierung?
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 167–180
Monitoring physiologischer Daten im Alltag: Quell wissenschaftlichen Fortschritts auf Kosten von Privatheit, Selbstbestimmung und Solidarität?
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 181–197
Haftungsrechtliche Rahmenbedingungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 201–216
Verantwortungslose Maschinen?
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 217–237
Die Datentreuhand in der medizinischen Forschung – eine Untersuchung aus juristischer Perspektive
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 241–262
Föderiertes Lernen: ein Hilfsmittel zur datenschutzkonformen Forschung in der Biomedizin und darüber hinaus
In: Digital Health und Recht (2024), pp. 263–284
















